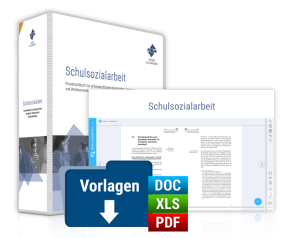Hilfeplanverfahren einfach erklärt: Definition, Ablauf und Beispiel
16.05.2024 | T. Reddel – Online-Redaktion, Forum Verlag Herkert GmbH

Sowohl das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) als auch die damit einhergegangene Reform des SGB VIII sorgen dafür, dass die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern vorangetrieben wird. Ein entscheidendes Werkzeug hierfür ist das Hilfeplanverfahren. Hiermit können Jugendämter spezielle Unterstützung anbieten, wenn die Sorgeberechtigten Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen. Aber wie sieht so ein Planverfahren aus, ist es verpflichtend und wie läuft es ab?
Inhaltsverzeichnis
- Definition: Was ist ein Hilfeplanverfahren?
- Was regelt der Hilfeplan?
- Wann ist ein Hilfeplanverfahren verpflichtend?
- Schritte: Wie läuft ein Hilfeplanverfahren ab?
- Wie erstelle ich einen Hilfeplan?
- Hilfeplanverfahren: Beispiel
- Fazit
Definition: Was ist ein Hilfeplanverfahren?
Das Hilfeplanverfahren ist eine Methode der Kinder- und Jugendhilfe, um Fördermaßnahmen zur Erziehung und Entwicklung von Minderjährigen durchzuführen. Der dazugehörige Hilfeplan beschreibt, welcher Bedarf vorliegt, welche Art von Hilfsangeboten genutzt werden und welche Leistungen damit einhergehen. Der Plan wird vor Beginn der Hilfe erstellt und in regelmäßigen Abständen überprüft.
Zu den möglichen Hilfsmaßnahmen, die im Plan beschrieben und eingesetzt werden können, gehören nach SGB VIII:
| Paragraf im SGB VIII | Art der Hilfe zu Erziehung |
| § 28 | Erziehungsberatung |
| § 29 | Soziale Gruppenarbeit |
| § 30 | Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe |
| § 31 | Sozialpädagogische Familienhilfe |
| § 32 | Erziehung in einer Tagesgruppe |
| § 33 | Vollzeitpflege |
| § 34 | Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform |
| § 35 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |
| § 41 | Hilfe für junge Volljährige |
Wichtig ist, dass stets die Perspektiven und Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt werden. Nur so können die Verantwortlichen ein Konzept erstellen, das die Kinder/Jugendlichen und ihre Familien bestmöglich fördert. Grundlage hierfür ist der Hilfeplan.
Was regelt der Hilfeplan?
Generell regelt der Hilfeplan, in welcher Form bereits geplante Hilfen zur Erziehung umgesetzt werden sollen. Er definiert die Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und Jugendhilfe/dem Jugendamt, den Sorgeberechtigten und allen anderen Beteiligten. Außerdem prüfen die Einrichtungen mithilfe des Plans, wie erfolgreich die Hilfe zur Erziehung verläuft und ob sie (weiterhin) angemessen ist.
Wann ist ein Hilfeplanverfahren verpflichtend?
Nach § 36 Abs. 2 SGB VIII sind Jugendämter dazu verpflichtet, für alle Hilfen zur Erziehung einen Hilfeplan zu erstellen. Lediglich Erziehungsberatungen, die nur für einen kurzen Zeitraum angelegt sind, fallen nicht unter diese Pflicht.
Zudem besagt § 36 Abs. 1 SGB VIII, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowohl die Sorgeberechtigten als auch die Kinder/Jugendlichen über folgende Punkte beraten müssen:
- Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- Geplante Änderungen von Art und Umfang der Hilfe
- Mögliche Folgen für die Entwicklung der Kinder/Jugendlichen
Die Beratung hat bereits vor der Entscheidung zur Erziehungshilfe zu erfolgen. Zudem muss die Beratung und Aufklärung so gestaltet sein, dass sie für alle Beteiligten verständlich, nachvollziehbar und wahrnehmbar ist.
Solche Hilfen zur Erziehung sind oftmals dann erforderlich, wenn die Sorgeberechtigten mit der Erziehung überfordert sind oder das Kind eine geistige oder körperliche Behinderung aufweist. In manchen Fällen kann sogar eine akute Kindeswohlgefährdung die Ursache dafür sein, dass ein Hilfeplanverfahren benötigt wird. Viele Fachkräfte sind jedoch verunsichert, wenn es darum geht, eine entsprechende Gefährdungseinschätzung in die Wege zu leiten.
Produktempfehlung
Rechtssichere Unterstützung erhalten pädagogische Fachkräfte mit der „Vorlagenmappe Kindeswohlgefährdung“. Darin sind direkt einsetzbare Checklisten und Merkblätter enthalten, die bei der Einschätzung der Situation helfen und den rechtssicheren Umgang mit Kindeswohlgefährdungen verständlich erklären.
Hilfeplanverfahren können aber auch Teil der Schulsozialarbeit sein: Probleme in der Entwicklung oder in der Erziehung zu Hause haben Auswirkungen auf das Verhalten in der Schule. Daher sollten sich ebenso Lehrkräfte und Schulleitungen darüber informieren, wie sie betroffene Kinder und Jugendliche mithilfe der Schulsozialarbeit bestmöglich unterstützen können. Passende Ideen und Anleitungen bietet das Praxishandbuch „Schulsozialarbeit“.
Schritte: Wie läuft ein Hilfeplanverfahren ab?
Kurzübersicht: Ablauf eines Hilfeplanverfahrens
1. Es erfolgt ein erstes Hilfeplangespräch zur Bestandsaufnahme mit den Beteiligten.
2. Die verantwortlichen Fachkräfte beraten sich über den Fall und ermitteln die passende Art der Hilfe.
3. Zusammen mit den Eltern und Kindern/Jugendlichen wird ein Hilfeplan erstellt.
4. Die im Plan festgelegten Maßnahmen werden umgesetzt.
5. In regelmäßigen Hilfeplangesprächen wird geprüft, wie geeignet die gewählten Hilfen sind und ob noch Bedarf besteht.
Für ein Hilfeplanverfahren müssen sich zunächst alle beteiligten Parteien zusammensetzen und über die akuten Probleme sprechen. Hierfür führt das zuständige Jugendamt mit den Sorgeberechtigten und dem Kind/Jugendlichen ein Erstgespräch durch. Am Ende dieses Beratungsprozesses kommt es zur Entscheidungsphase, in der sich die Fachkräfte für eine Erziehungshilfe entscheiden. Dieser Beschluss wird anschließend in einem entsprechenden Hilfeplan zusammengefasst.
Sobald der Plan steht, werden die festgelegten Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt. Danach treffen sich die beteiligten Personen regelmäßig zu speziellen Hilfeplangesprächen. Dort besprechen sie folgende Punkte:
- Aktueller Entwicklungsstand des/der Minderjährigen
- Offene Probleme
- Angemessenheit der Erziehungshilfen
- Konkrete (Erziehungs-)Ziele
Mit diesen Hilfeplangesprächen stellen die Beteiligten sicher, dass die gewählten Hilfen zur Erziehung wirksam sind. Sie können damit aber auch Alternativen suchen oder die Hilfsmaßnahmen beenden, sobald die geplanten Ziele erreicht wurden.
Wie erstelle ich einen Hilfeplan?
Bei der Erstellung ist in jedem Fall wichtig, dass alle beteiligten Personen zu Wort kommen. Auch eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen am Hilfeplanverfahren ist essenziell. Insgesamt sollten folgende Parteien involviert werden:
- Fallverantwortliche Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
- Eltern/Sorgeberechtigte der Kinder und Jugendlichen
- Betroffene Kinder und Jugendliche selbst
- Personen, die an der Durchführung der Hilfe beteiligt sind, z. B.:
- Heimerzieherinnen und -erzieher
- Sozialpädagogische Familienhelferinnen und -helfer
- Betreuungshelferinnen und -helfer
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, weitere Personen in das Hilfeplanverfahren miteinzubeziehen. Infrage kommen z. B. Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder oder Therapeutinnen und Therapeuten. Auf dieser Basis können die Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter entsprechende Maßnahmen ableiten, um die Erziehung und Entwicklung der betroffenen Minderjährigen zu fördern.
Außerdem ist es wichtig, die Erkenntnisse und die geplanten Maßnahmen sinnvoll zu dokumentieren.
Hilfeplanverfahren: Beispiel
Grundsätzlich stellen die Länder teils unterschiedliche Anforderungen an die Arbeit der Jugendämter hinsichtlich des Hilfeplanverfahrens. Allerdings lassen sich bestimmte Grundzüge auch auf andere Länder übertragen. So veröffentlichte die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter im Jahr 2015 passende Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII.
Gratis-Download
Eine fertige Vorlage für die Gestaltung von Hilfeplanverfahren bietet unser Gratis-Download. Darin finden Sie ein kostenloses Beispiel für ein Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII, das u. a. bei der Durchführung von Hilfeplangesprächen unterstützt. Jetzt herunterladen!
Fazit
Mit einem Hilfeplanverfahren erhalten Familien Unterstützung bei der Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder. Ein strukturiertes Vorgehen gilt dabei als wesentliche Grundlage, um den betroffenen Familien die erforderliche Unterstützung zukommen zu lassen. Daher müssen die zuständigen Jugendämter sich zunächst mit verschiedenen Beteiligten zusammensetzen und einen Hilfeplan erstellen. Daraus können sie entsprechende Fördermaßnahmen ableiten, die im Planverfahren umgesetzt werden. Besonderer Förderbedarf ist gefragt, wenn z. B. eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt.
Quellen: Praxishandbuch „Schulsozialarbeit“, Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, Jugendamt des Landkreises Hildesheim, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)