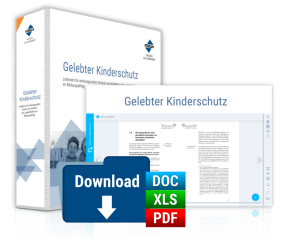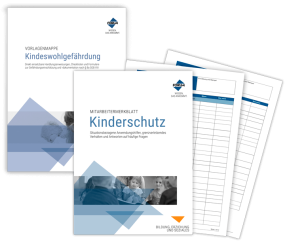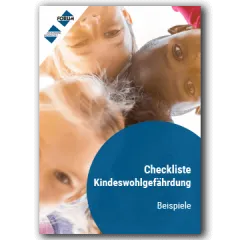Inobhutnahme Jugendamt: Voraussetzungen, Ablauf und gesetzliche Vorgaben
05.08.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH
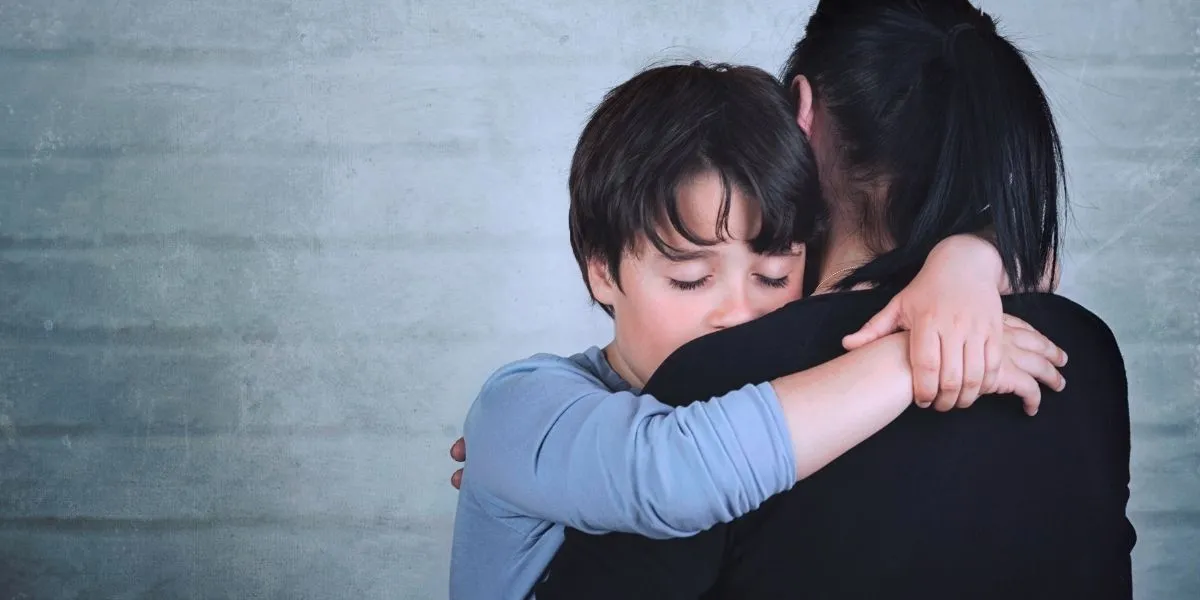
Im Jahr 2024 nahmen die Jugendämter in Deutschland knapp 70.000 Kinder und Jugendliche in Obhut. Dabei sank zwar die Zahl der Inobhutnahmen durch unbegleitete Einreisen. Allerdings stieg der Anteil dringender Kindeswohlgefährdungen und Selbstmeldungen. Wie eine solche Inobhutnahme abläuft, wann sie erfolgt und welche Befugnisse das Jugendamt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Aktuelle Statistik zur Inobhutnahme in Deutschland
- Ablauf einer Inobhutnahme durch das Jugendamt
- Wann darf das Jugendamt ein Kind in Obhut nehmen?
- Welche Befugnisse umfasst die Inobhutnahme nach Paragraf 42 SGB VIII?
- Wie lange darf das Jugendamt ein Kind in Obhut nehmen?
- Wer ist für die Inobhutnahme zuständig?
Was ist eine Inobhutnahme?
Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist eine zeitlich befristete, sozialpädagogische Schutzmaßnahme des Jugendamts. Hierbei erhalten die Betroffenen übergangsweise eine andere Unterkunft. Das soll sie vor einer möglichen Kindeswohlgefährdung schützen und ihre weitere Unterbringung regeln. Währenddessen kümmert sich das Jugendamt um das Wohl der Kinder, bietet Beratung an und leitet bei Bedarf weitere rechtliche Schritte in die Wege.
Aktuelle Statistik zur Inobhutnahme in Deutschland
Am 28. Juli 2025 veröffentlichte das Statistische Bundesamt neue Fallzahlen zur vorübergehenden Inobhutnahme durch das Jugendamt für das Jahr 2024.
Das sind die wichtigsten Kennzahlen und Erkenntnisse:
-
Gesamtzahl 2024:
- Rund 69.500 Inobhutnahmen durch das Jugendamt
- Sieben Prozent weniger Schutzmaßnahmen als 2023 (≈ 5.100 Kinder und Jugendliche)
→ Erstmaliger Rückgang der Fallzahlen seit 2021
-
Änderung der genauen Fallzahlen:
- 22 Prozent weniger Inobhutnahmen nach unbegleiteten Einreisen aus dem Ausland (≈ 8.500 Fälle)
- 10 Prozent mehr Schutzmaßnahmen aufgrund dringender Kindeswohlgefährdungen (≈ 2.600 Fälle)
- 10 Prozent mehr Selbstmeldungen von betroffenen Kindern und Jugendlichen (≈ 850 Fälle)
-
Häufigste Anlässe und Meldeformen für Inobhutnahme:
- Unbegleitete Einreise (44 Prozent)
- Dringende Kindeswohlgefährdung (42 Prozent)
- Überforderung der Eltern (25 Prozent)
- Selbstmeldung (13 Prozent)
- Körperliche Misshandlungen (11 Prozent)
- Psychische Misshandlungen (8 Prozent)
-
Dauer der Maßnahmen:
- Durchschnittliche Dauer: 62 Tage (+ 12 Tage im Vergleich zu 2023)
- Selbstmeldungen: 36 Tage
- Dringende Kindeswohlgefährdungen: 57 Tage
- Unbegleiteten Einreisen aus dem Ausland: 74 Tage
- Weniger als eine Woche (30 Prozent)
- Drei Monate oder länger (21 Prozent)
Insgesamt sank die Zahl der durch das Jugendamt durchgeführten Inobhutnahmen erstmals seit 2021 wieder. Gleichzeitig gab es den größten Anstieg bei körperlichen Misshandlungen und Vernachlässigungen. Zudem stieg die durchschnittliche Dauer der Schutzmaßnahmen um 24 Prozent.
Ablauf einer Inobhutnahme durch das Jugendamt
Wenn sich Kinder oder Jugendliche in einer akuten Notlage befinden, kann das Jugendamt mithilfe einer Inobhutnahme kurzfristig handeln.
Wie diese Schutzmaßnahme abläuft, zeigt folgender Ablauf – orientiert an § 42 SGB VIII:
| 1. Mögliche Kindeswohlgefährdung feststellen |
|
| 2. Jugendamt informieren |
|
| 3. Erste Gefährdungseinschätzung |
|
| 4. Über Inobhutnahme entscheiden |
|
| 5. Vorläufige Unterbringung und Aufklärung |
|
| 6. Sorgeberechtige informieren |
|
| 7. Familiengericht einschalten |
|
| 8. Ende der Inobhutnahme |
|
Nach Ende der Inobhutnahme kehren die Betroffenen entweder an ihren vorherigen Aufenthaltsort zurück oder kommen an einem neuen Ort unter, wie etwa einem Heim oder einer betreuten Wohngruppe. Es ist jedoch auch möglich, dass ein anderes Jugendamt die Betroffenen übernimmt oder die Inobhutnahme vorzeitig endet, weil sie von den Betroffenen selbst aufgelöst wird.
Darüber hinaus kann das Jugendamt nach Abschluss der Inobhutnahme weitere Hilfen anbieten, beispielsweise ambulante Erziehungshilfen oder psychologische Betreuung.
Wann darf das Jugendamt ein Kind in Obhut nehmen?
Nach § 42 Absatz 1 SGB VIII kann und muss das Jugendamt Kinder und Jugendliche in Obhut nehmen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
- Das Kind bittet selbst um Obhut (freiwillige Inobhutnahme).
- Es besteht dringende Gefahr für das Kindeswohl und die Personensorgeberechtigten widersprechen nicht.
- Das Kindeswohl ist dringend gefährdet und es kann keine rechtzeitige familiengerichtliche Entscheidung eingeholt werden.
- Ein ausländisches Kind kommt unbegleitet nach Deutschland und es halten sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland auf.
Laut Statistischem Bundesamt zählen zu den häufigsten Gründen für eine Inobhutnahme durch das Jugendamt:
- Unbegleitete Einreisen
- Überforderung der Eltern
- Vernachlässigung
- Körperliche Misshandlung
- Psychische Misshandlung
Welche Befugnisse umfasst die Inobhutnahme nach Paragraf 42 SGB VIII?
Zu den gesetzlichen Befugnissen einer Inobhutnahme gehört es insbesondere, die Betroffenen bei einer geeigneten Person, Einrichtung oder sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Besteht eine dringende Gefahr für das Kindeswohl, dürfen Kinder oder Jugendliche auch von einer anderen Person weggenommen werden (§ 42 Absatz 1 Satz 2 SGB VIII).
Während der Inobhutnahme darf das Jugendamt alle Rechtshandlungen vornehmen, die zum Wohl der Kinder und Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei muss es den mutmaßlichen Willen der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten angemessen berücksichtigen (§ 42 Absatz 2 Satz 4 SGB VIII).
Kann das Jugendamt die Inobhutnahme verweigern?
Das Jugendamt kann eine Inobhutnahme ablehnen, wenn es feststellt, dass keine akute Kindeswohlgefährdung erkennbar ist. Es ist jedoch verpflichtet vorab zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Inobhutnahme nach dem SGB VIII vorliegen. Eine direkte Verweigerung ohne vorherige Prüfung ist also nicht möglich.
Wie lange darf das Jugendamt ein Kind in Obhut nehmen?
Es gibt keine gesetzlich festgelegte Mindest- oder Höchstdauer für eine amtliche Inobhutnahme. Sie sollte generell so kurz wie möglich sein und umfasst in der Regel wenige Tage bis mehrere Monate.
→ Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Dauer einer Inobhutnahme in Deutschland im Schnitt 62 Tage (2023: 50 Tage).
Grundsätzlich endet eine Inobhutnahme, sobald das Kind an die Personensorgeberechtigten übergeben werden kann oder andere geeignete Hilfen nach dem SGB VIII gewährt werden.Wer ist für die Inobhutnahme zuständig?
Zuständig ist das örtliche Jugendamt, in dessen Bezirk sich das Kind vor Beginn der Maßnahme aufhält (§ 87 SGB VIII) .
Das Jugendamt arbeitet mit Schulen, Kitas, der Polizei und anderen Stellen zusammen. Bei akuter Gefahr kann jede Person das Jugendamt informieren. Pädagogische Fachkräfte sind gemäß § 8a SGB VIII sogar zur Meldung verpflichtet, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.
Kosten der Inobhutnahme
Die Kosten für die Unterbringung in Obhut trägt grundsätzlich die öffentliche Jugendhilfe. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zu einer Kostenbeteiligung der Eltern kommen, insbesondere bei längeren Maßnahmen oder bei freiwilligen Inobhutnahmen. Die genaue Kostenregelung ist bei den zuständigen Jugendämtern zu erfragen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, „Vorlagenmappe Kindeswohlgefährdung“, Handbuch „Gelebter Kinderschutz“, IJAB (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.)