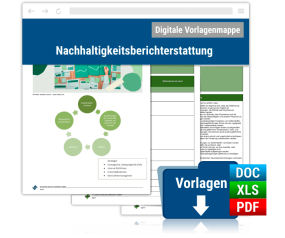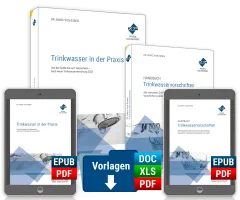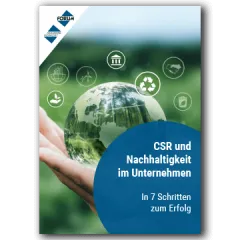Was ist die Carbon Leakage Verordnung (BECV)? Überblick & Pflichten
10.07.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Durch strenge Auflagen soll die Carbon-Leakage-Verordnung (BECV) verhindern, dass energieintensive Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, um den nationalen CO₂-Preis zu umgehen. Der Fachbeitrag zeigt, welche Branchen entlastet werden können, ohne die Klimaschutzziele zu gefährden, wie die Antragstellung bei der DEHSt funktioniert und welche ökologischen Gegenleistungen ab 2025 verpflichtend sind. Ein kompakter Überblick für alle, die Klimaschutz, Energieeffizienz und Beihilferecht in der Praxis zusammenbringen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist die Carbon Leakage Verordnung?
- Für wen gilt die BECV?
- Der BECV Antrag: Ablauf und Fristen
- BECV: die wichtigsten Paragraphen im Überblick
- Ökologische Gegenleistung nach BECV
- Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und die BECV
- BECV und neueste Auswertung des Umweltbundesamts
- Fazit
Was ist die Carbon Leakage Verordnung?
Die Carbon Leakage Verordnung – offiziell „Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel“ (BECV) – ist am 28. Juli 2021 in Kraft getreten. Die Abkürzung BECV steht für: Brennstoff – Emissions – Carbon – Verordnung.
Diese Verordnung wurde auf Grundlage von Paragraph 11 Absatz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) erlassen und hat die Aufgabe, Unternehmen, die durch den nationalen CO₂-Preis im internationalen Wettbewerb benachteiligt wären, vor einer Abwanderung („Carbon Leakage“) zu schützen.
Für wen gilt die BECV?
Die BECV gilt für Unternehmen, die in besonders emissionsintensiven und international wettbewerbsfähigen Sektoren tätig sind. Diese Sektoren werden in einer Positivliste nach NACE-Codes definiert (zum Beispiel Chemie, Stahl, Keramik, Kunststoffe). Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) ist für die Umsetzung und das Antragsverfahren zuständig.
Die beihilfeberechtigten BECV Sektoren umfassen unter anderem:
- Herstellung von Sanitärkeramik
- Produktion von Stahlrohren
- Herstellung von Kunststoffen in Primärformen
- Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale
- Veredlung von Textilien und Bekleidung
Der BECV Antrag: Ablauf und Fristen
Unternehmen, die eine Entlastung beantragen möchten, müssen jährlich einen BECV Antrag bei der DEHSt stellen. Die Frist endet jeweils am 30. Juni des Folgejahres. Die Antragstellung erfolgt elektronisch und erfordert eine Bestätigung durch eine prüfungsbefugte Stelle (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer).
Voraussetzungen für die Antragstellung sind:
- Zugehörigkeit zu einem beihilfeberechtigten Sektor
- Betrieb eines zertifizierten Energie- oder Umweltmanagementsystems (§ 10 BECV)
- Nachweis ökologischer Gegenleistungen (§§ 10 - 12 BECV)168
Veranstaltungsempfehlung
Die Anforderungen der Carbon Leakage Verordnung stellen viele Unternehmen vor neue Herausforderungen im Bereich Nachweisführung und Nachhaltigkeitsdokumentation.
Wie Sie diese Anforderungen rechtskonform und effizient im Rahmen der CSRD und ESRS umsetzen, trainieren Sie in der Inhouse-Schulung „Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD/ESRS im Unternehmen umsetzen“. Jetzt hier informieren!
Ökologische Gegenleistung nach BECV
Eine zentrale Neuerung der BECV ist die Verpflichtung zu ökologischen Gegenleistungen. Unternehmen müssen ab dem Abrechnungsjahr 2023 nachweisen, dass sie ein Energie- oder Umweltmanagementsystem betreiben und in Maßnahmen zur Energieeffizienz oder Dekarbonisierung investieren.
Details zu den ökologischen Gegenleistungen
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder Umweltmanagementsystem nach EMAS
- für kleinere Unternehmen (<10 GWh fossiler Energieverbrauch) genügt ein nicht zertifiziertes System nach ISO 50005 oder die Mitgliedschaft in einem Energieeffizienznetzwerk
- Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen oder Dekarbonisierung (Paragraph 11 BECV)
- Nachweis der Maßnahmen und Investitionen (Paragraph 12 BECV)
→ Ab 2025 müssen mindestens 80 Prozent der erhaltenen Entlastungssumme in entsprechende Maßnahmen investiert werden.
Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und die BECV
Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) ist seit November 2023 in Kraft und verpflichtet große Unternehmen (ab 7,5 GWh Endenergieverbrauch pro Jahr), bis spätestens 18. Juli 2025 ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einzuführen. Die Anforderungen des EnEfG ergänzen die Vorgaben der BECV und setzen zusätzliche Impulse für Energieeinsparungen und Klimaschutz.
Für wen gilt das neue Energieeffizienzgesetz?
Das EnEfG gilt für Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 7,5 GWh. Diese Unternehmen müssen ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem einführen und Umsetzungspläne für Energieeinsparmaßnahmen erstellen.
BECV und neueste Auswertung des Umweltbundesamts
Die jüngste Evaluierung der BECV durch das Umweltbundesamt (UBA) bietet einen aktuellen, datenbasierten Einblick in die Wirksamkeit und Herausforderungen dieser Verordnung.
Neuberechnung des Carbon-Leakage-Indikators
Ein zentrales Ergebnis der Auswertung ist die Neuberechnung des Carbon-Leakage-Indikators (CLI) auf Basis deutscher Daten für die Jahre 2018 bis 2021. Von den 230 Sektoren des verarbeitenden Gewerbes überschreiten 40 Sektoren den relevanten Schwellenwert von 0,2 und gelten damit als Carbon-Leakage-gefährdet. Dies entspricht einem Anteil von 17 Prozent aller Sektoren. Die Neuberechnung zeigt geringfügige Abweichungen zur bestehenden BECV-Liste, die auf der EU-ETS-1-Liste basiert, da nun ausschließlich deutsche Daten und direkte Emissionen berücksichtigt werden.
Besonders gefährdete Sektoren finden sich in den Bereichen
- Glas und Glaswaren,
- Keramik,
- Metallerzeugung,
- chemische Erzeugnisse sowie
- Papier- und Pappherstellung.
Herausragend emissionsintensiv zeigen sich die Sektoren
- Zementherstellung,
- Erzeugung von Roheisen und Stahl sowie
- die Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen.
Volkswirtschaftliche Analyse: Keine Verlagerungseffekte erkennbar
Die deskriptive Analyse volkswirtschaftlicher Kennzahlen zeigt für den Untersuchungszeitraum keinen erkennbaren negativen Effekt des nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) auf die betroffenen Sektoren. Insbesondere konnten keine Verluste von Arbeitsplätzen in den BECV-Sektoren festgestellt werden.
Die Strukturanalyse kommt zu dem Schluss, dass derzeit kein Bedarf für eine Erhöhung des Kompensationsgrads oder eine Absenkung des Carbon-Leakage-Indikators für nachträgliche Sektorerweiterungen besteht. Die Kosten für BECV-Sektoren nach Erhalt der Kompensation sowie für andere Sektoren ohne Kompensation sind aktuell gering, und es ist kein Verlust von Arbeitsplätzen ersichtlich.
Ein signifikanter Anteil der BECV-Sektoren erfährt nach Erhalt der Kompensation nur eine sehr geringe Kostenerhöhung durch das nEHS. Die Evaluierung schließt daher die Einführung eines nationalen Korrekturfaktors nicht aus, der die Kompensationsgrade sektorübergreifend reduziert, empfiehlt jedoch eine weitere Prüfung.
Optimierungspotential bei Komplexität
Die Prozessanalyse identifiziert keine signifikanten Schwachstellen im Beihilfeprozess. Allerdings stellt sie Optimierungspotential fest: vor allem mit Blick auf die Komplexität von Informationsmaterialien sowie die Schnittstellen zwischen Informationssystemen. Die Evaluierung empfiehlt zusätzliche Ressourcen für kleine und mittlere Unternehmen, um die Anforderungen und Nachweispflichten besser zu verstehen und zu erfüllen.
Fazit
Die Carbon Leakage Verordnung (BECV) stellt ein wichtiges Instrument zum Schutz energieintensiver deutscher Unternehmen vor internationalen Wettbewerbsnachteilen dar. Die Verordnung, die am 28. Juli 2021 in Kraft trat, gewährt Beihilfen für Unternehmen aus 40 emissionsintensiven Sektoren, um eine Abwanderung ins Ausland zu verhindern.
Ein zentrales Element sind die ökologischen Gegenleistungen, die ab 2023 ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem sowie Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen vorschreiben. Diese Investitionspflicht steigt von 50 Prozent der Beihilfe (2023 bis 2024) auf 80 Prozent ab 2025. Eine aktuelle Evaluierung des Umweltbundesamts zeigt positive Ergebnisse: keine erkennbaren Verlagerungseffekte oder Arbeitsplatzverluste in gefährdeten Sektoren.
Die Kombination mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) verstärkt den Transformationsdruck auf große Unternehmen, die bereits ab 7,5 GWh Energieverbrauch Managementsysteme einführen müssen. Optimierungspotenzial besteht hauptsächlich bei der Reduzierung der Komplexität für kleine und mittlere Unternehmen. Die BECV fungiert effektiv als Brückentechnologie zwischen nationalem CO₂-Preis und internationalem Klimaschutz.
Quellen: „Zoll & Export“; Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Evaluierung des Umweltbundesamts;