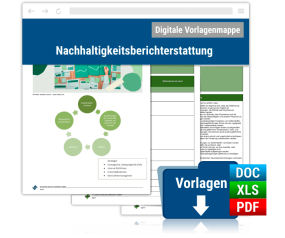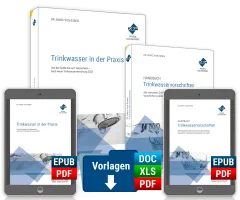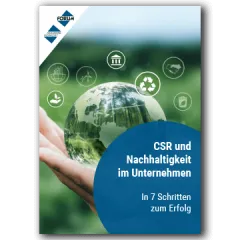Carbon Capture and Storage: Definition, Anwendungsgebiete und Perspektiven
08.04.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Die Reduktion von CO₂-Emissionen ist eine globale Notwendigkeit – vor allem für Industrienationen, die ihre Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens erfüllen wollen. Carbon Capture and Storage (CCS, oder „CO₂-Abscheidung und -Speicherung“) tritt hier als strategischer Hoffnungsträger auf den Plan. Die Technologie ermöglicht es, Treibhausgase direkt an ihrer Quelle abzuscheiden, sicher zu transportieren und dauerhaft unter der Erde zu speichern – ohne bestehende Produktionsprozesse komplett umzustellen. Worum geht es bei Carbon Capture and Storage? Welche wirtschaftlichen Chancen eröffnet es? Und wie steht es um die ökologische Verantwortung? Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Aspekte dieser Technologie.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Carbon Capture and Storage (CCS)? – Definition
- Ziele und betriebswirtschaftliche Vorteile von Carbon Capture and Storage
- Technische Umsetzung: Methoden und Herausforderungen
- Regulatorische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz von Carbon Capture and Storage
- Carbon Capture and Storage: ökologische Risiken und langfristige Perspektiven
- FAQs zu Carbon Capture and Storage
- Fazit: Carbon Capture and Storage als strategisches Werkzeug für Klimaziele
Was ist Carbon Capture and Storage (CCS)? – Definition
Die Reduktion von CO₂-Emissionen steht im Fokus globaler Klimastrategien. Das gilt vor allem für Industrienationen, die sich im Rahmen des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Erderwärmung verpflichtet haben. Carbon Capture and Storage (CCS oder auch CO₂-Abscheidung und -Speicherung) etabliert sich hierbei als innovative Schlüsseltechnologie, um industrielle Treibhausgasemissionen effizient zu reduzieren, ohne Produktionsketten unmittelbar zu unterbrechen.
Nach dem Regierungswechsel im Februar 2025 wird das Thema Carbon Capture and Storage in Deutschland wieder verstärkt auf die politische Agenda gesetzt. So plant die neue Regierung Stand März 2025, die Technologie zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid in Industrieprozessen zu ermöglichen.
Ein wichtiger Bestandteil ist das geplante Kraftwerkssicherheitsgesetz, das die Absicherung der Energiewende durch neue Gaskraftwerke vorsieht. Diese sollen teilweise mit Carbon Capture and Storage-Technologie ausgestattet werden. Zudem wird eine Novellierung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) angestrebt, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von CO2-Speichern zu verbessern.
Es gibt jedoch noch rechtliche Hürden, insbesondere im Hinblick auf den Export von CO2 ins Ausland und die Offshore-Speicherung vor Norwegen.
Was sind die Vor- und Nachteile von Carbon Capture and Storage?
Ziele und betriebswirtschaftliche Vorteile von Carbon Capture and Storage
Die primäre Zielsetzung von Carbon Capture and Storage liegt in der deutlichen Senkung industrieller CO₂-Emissionen. Das gilt besonders für Sektoren wie Stahlproduktion, Zementherstellung und energieintensive Grundstoffindustrie, wo direkte Elektrifizierung oder alternative Verfahren aktuell technisch oder wirtschaftlich nicht realisierbar sind.
Studien des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) belegen, dass die Integration von CCS-Systemen die Erreichung von Science-Based Targets in der Schwerindustrie um bis zu 40 Prozent beschleunigen kann. Die Skaleneffekte führen bei breiter Markteinführung zu weiter sinkenden Implementierungskosten.
Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive bieten solche nationalen Klimaschutzprogramme nicht nur steuerliche Anreize, sondern helfen auch bei der Vermeidung steigender CO₂-Zertifikatekosten im EU-Emissionshandelssystem. Gleichzeitig lassen sich neue Geschäftsfelder in der Planung modularer Abscheidungsanlagen oder der Entwicklung von Monitoring-Systemen für Speicherstätten erschließen. Zudem eröffnet die Technologie narratives Potenzial, um unternehmensinterne Klimaambitionen öffentlichkeitswirksam zu vermitteln und die langfristige Strategie zur Dekarbonisierung gegenüber Investoren zu untermauern.
Produktempfehlung:
Damit der Klimawandel wirksam aufgehalten wird, müssen Maßnahmen wie Carbon Capture and Storage mit einer ganzheitlichen Strategie zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit kombiniert werden.
Das Praxishandbuch „Planung und Ausführung nach GEG“ bietet dazu praxisorientierte Unterstützung, damit Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes umsetzen und so einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten können. Bestellen Sie es jetzt direkt hier!
Technische Umsetzung: Methoden und Herausforderungen
Moderne Carbon Capture and Usage-Verfahren unterscheiden drei Abscheidungsmethoden, deren Anwendung sich nach den spezifischen Gegebenheiten der Emissionsquelle richtet:
1. Die Post-Combustion-Abscheidung trennt CO₂ aus Rauchgasen mittels chemischer Waschlösungen wie Aminen. Sie eignet sich besonders für nachträgliche Nachrüstungen bestehender Kraftwerke.
2. Pre-Combustion-Verfahren setzen auf die Vergasung fossiler Brennstoffe vor der Verbrennung, wobei CO₂ bereits im Synthesegasstrom abgetrennt wird. Der Ansatz besitzt hohen Wirkungsgrad, bringt aber signifikanten Investitionskosten.
3. Die Oxyfuel-Technologie nutzt reinen Sauerstoff statt Luft für Verbrennungsprozesse. Das ermöglicht konzentrierte CO₂-Ströme. Verursacht jedoch hohen Energiebedarf für die Sauerstoffproduktion.
Transport und Speicher
Der Transport des abgetrennten CO₂ erfolgt typischerweise über Pipelines oder Schiffstransporte. Dabei kann die Logistik bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten beanspruchen.
Geologische Speicher wie salinare Aquifere müssen strenge Sicherheitskriterien erfüllen: Gesteinsschichten mit porösen Speichergesteinen und undurchlässigen Deckschichten gewährleisten die dauerhafte Einschlussfähigkeit. Umweltgutachterinnen und Umweltgutachter übernehmen hier eine Schlüsselrolle bei der Bewertung geologischer Risiken und der Entwicklung von Leckage-Frühwarnsystemen.
Regulatorische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz von Carbon Capture and Storage
Die Einführung von Carbon Capture and Usage-Technologien erfordert klare rechtliche Vorgaben zur Haftung bei Leckagen, Langzeitüberwachung von Speichern und grenzüberschreitendem CO₂-Transport. In der Europäischen Union bildet die überarbeitete CCS-Richtlinie (2023) den Rahmen für Genehmigungsverfahren, während das deutsche Kohlendioxid-Speichergesetz (KSpG) die Nutzung onshore-Speicher bis auf Pilotprojekte beschränkt.
Sozialwissenschaftliche Studien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz maßgeblich von transparenten Informationskampagnen und partizipativen Planungsverfahren abhängt. In Regionen mit geplanten Speicherprojekten wie Schleswig-Holstein gewinnen dialogorientierte Formate an Bedeutung, in denen die lokale Befölkerung Bedenken hinsichtlich Grundwasserbelastung oder Erdbebenrisiken klären können.
Carbon Capture and Storage: ökologische Risiken und langfristige Perspektiven
Kritische Stimmen verweisen auf potenzielle ökologische Risiken durch Carbon Capture and Usage wie Leckagen, die zu Versauerung von Grundwasser führen könnten, oder auf den zusätzlichen Energiebedarf der Abscheidungsprozesse, der je nach Verfahren 10 bis 40 Prozent der Kraftwerksleistung beansprucht. Fortschritte in Membrantechnologien – etwa die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen (MOFs) zur effizienteren CO₂-Abtrennung – reduzieren diesen Energieverbrauch durch Carbon Capture and Usage jedoch kontinuierlich. Die Kopplung von Carbon Capture and Usage-Anlagen mit erneuerbaren Energien zur Stromversorgung, wie im norwegischen Projekt „Northern Lights“ realisiert, minimiert zudem die indirekten Emissionen der Technologie.
Für Nachhaltigkeitsbeauftragte und jeden, der für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zuständig ist, bleibt die strategische Abwägung zentral, ob CCS als Brückentechnologie für Übergangsphasen oder als dauerhafter Baustein einer kreislauforientierten CO₂-Wirtschaft konzipiert wird. Die Integration in übergeordnete Klimastrategien erfordert die Kombination mit negativen Emissionstechnologien wie Direct Air Capture, um Netto-Null-Ziele zu erreichen.
FAQs zu Carbon Capture and Storage
1. Ist Carbon Capture and Storage sicher? Ja, bei korrekter Umsetzung und Überwachung gilt CCS als technisch sicher – Leckage-Risiken werden durch moderne Monitoring-Technologien minimiert.
2. Wo wird CCS aktuell eingesetzt? Neben Norwegen und Kanada gibt es Pilotprojekte in den Niederlanden, Großbritannien und Norddeutschland (z. B. Ketzin).
3. Welche Branchen profitieren am meisten von Carbon Capture and Storage? Industrien mit unvermeidbaren Prozessemissionen wie Zement, Stahl, Chemie oder Raffinerien.
4. Wie hoch sind die Kosten für CCS? Die Kosten variieren stark. Studien zeigen: Skaleneffekte und Förderprogramme können CCS mittelfristig wirtschaftlich machen.
5. Gibt es Alternativen zu Carbon Capture and Storage? Ja – etwa Direct Air Capture (DAC) oder Bioenergie mit CCS (BECCS) – beide werden ergänzend betrachtet.
6. Wird Carbon Capture and Storage auch in Deutschland flächendeckend kommen? Das hängt von der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung ab. Derzeit ist eine schrittweise Einführung wahrscheinlich.
Fazit: Carbon Capture and Storage als strategisches Werkzeug für Klimaziele
Carbon Capture and Storage stellt kein Allheilmittel dar. Aber es kann andere Dekarbonisierungsmaßnahmen wie Energieeffizienzsteigerungen oder den Ausbau erneuerbarer Energien ergänzen. Für Betriebe mit hohen Prozessemissionen in der Zement-, Chemie- oder Stahlindustrie bietet die Technologie jedoch kurzfristige Entlastungspotenziale, um Transformationspfade im Einklang mit dem European Green Deal zu gestalten.
Entscheidungsträger sollten standortspezifische Machbarkeitsstudien initiieren, die technische Umsetzbarkeit, Kosteneffizienz und regulatorische Rahmenbedingungen integrativ bewerten. Die Prüfung staatlicher Förderprogramme – etwa im Rahmen des EU-Innovationsfonds oder nationaler Carbon Contracts for Difference – ist ebenso essenziell wie die frühzeitige Etablierung von Stakeholder-Dialogen mit lokalen Gemeinden, Umweltverbänden und Aufsichtsbehörden. Die Weiterbildung von Mitarbeitern in CCS-relevanten Kompetenzfeldern wie Geologie, Risikomanagement oder CO₂-Logistik entwickelt sich zum strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen, die langfristige Klimaresilienz anstreben.
Quellen: www.energie.de/; https://sciencebasedtargets.org; www.bund.net; Umweltbundesamt;