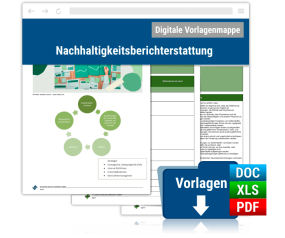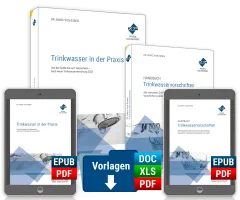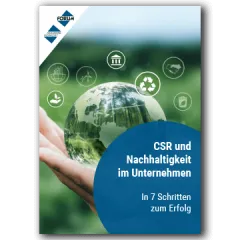Umweltverträglichkeitsprüfung: vom Screening bis zur Entscheidung
02.07.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist ein zentrales Instrument zur frühzeitigen Bewertung von Umweltauswirkungen geplanter Vorhaben. Dieser Fachbeitrag gibt einen kompakten Überblick über rechtliche Grundlagen, Verfahrensabläufe und Akteursrollen – mit Fokus auf die Novellierung des UVPG, die am 29. April 2025 im Bundesanzeiger bekannt gegeben wurde, und die Einbindung in bauplanungsrechtliche Verfahren. Ein praxisnaher Leitfaden für Vorhabenträger, Planer und Behörden.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist das UVP-Gesetz? Rechtliche Grundlagen und gesetzlicher Rahmen
- UVPG Anlage 1: Katalog UVP-pflichtiger Vorhaben
- Wann ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig?
- Was bedeutet Paragraph 7 Abs. 3 UVPG?
- Was beinhaltet eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
- Wie hoch sind die Kosten für eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
- UVPG: Verfahrensablauf und Zeitrahmen
- Fazit: Umweltverträglichkeitsprüfung als Grundlage für nachhaltige Vorhaben
Was ist das UVP-Gesetz? Rechtliche Grundlagen und gesetzlicher Rahmen zur Umweltverträglichkeitsprüfung
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des UVPG (UVPVwV), die zuletzt 1995 neu gefasst worden ist, ergänzt das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Mit ihren detaillierten Bestimmungen für die Ausführung einzelner Vorschriften des UVPG soll sie den Vollzug der Umweltverträglichkeitsprüfung erleichtern, von der Erstellung des Umweltberichts bis hin zur Überwachung. Die Fassung vom 14. April 2025 wurde an zahlreiche Gesetzesänderungen und an die Rechtsprechung angepasst.
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bildet die zentrale Rechtsgrundlage für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Deutschland. Das Gesetz dient der Umsetzung europäischer Richtlinien, insbesondere der UVP-Richtlinie 2011/92/EU, und wurde zuletzt 2024 novelliert.
→ Die UVP ist als unselbständiger Bestandteil in die jeweiligen Zulassungsverfahren integriert, was bedeutet, dass sie kein eigenständiges Verfahren darstellt.
Integration mit dem Baugesetzbuch (BauGB)
Im Bereich der Bauleitplanung regelt Paragraph 249 BauGB spezielle Vorschriften für Windenergieanlagen an Land. Diese Bestimmung ist relevant für die Verknüpfung von UVP-Verfahren mit bauplanungsrechtlichen Entscheidungen. Bei bauplanungsrechtlichen Vorhaben findet die UVP nach den Nummern 18.1 bis 18.8 der Anlage 1 zum UVPG Anwendung.
UVPG Anlage 1: Katalog UVP-pflichtiger Vorhaben
Die Anlage 1 zum UVPG enthält eine systematische Liste aller UVP-pflichtigen Vorhaben. Diese gliedert sich in verschiedene Kategorien wie Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie (Nummer 1), chemische Industrie (Nummer 2) bis hin zu bauplanungsrechtlichen Vorhaben (Nummern 18.1 bis 18.8). Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen:
- unbedingter UVP-Pflicht
- allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls
- standortbezogener Vorprüfung des Einzelfalls
Wann ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig?
Die UVP-Pflicht ergibt sich primär aus der Auflistung in der Anlage 1 zum UVPG. Ein Vorhaben ist UVP-pflichtig, wenn es die dort genannten Merkmale aufweist und gegebenenfalls die angegebenen Größen- oder Leistungswerte erreicht oder überschreitet.
Screening-Verfahren und Vorprüfung
Bei Vorhaben mit dem Kennzeichen „A“ oder „S“ in Spalte 2 der Anlage 1 führt die zuständige Behörde eine Vorprüfung durch. Diese überschlägige Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.
Kumulative Vorhaben
Auch mehrere kleinere Vorhaben können zusammen die Schwellenwerte erreichen und damit UVP-pflichtig werden. Das Gesetz erfasst unter dem Begriff des kumulierenden Vorhabens auch solche, die von mehreren Trägern verwirklicht werden sollen.
Was bedeutet Paragraph 7 Abs. 3 UVPG?
Paragraph 7 Abs. 3 UVPG regelt die freiwillige UVP. Diese Bestimmung besagt: „Die Vorprüfung nach den Absätzen 1 und 2 entfällt, wenn der Vorhabenträger die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt und die zuständige Behörde das Entfallen der Vorprüfung als zweckmäßig erachtet“. Das bedeutet konkret:
- Der Vorhabenträger kann freiwillig eine UVP beantragen.
- Die Behörde muss das Entfallen der Vorprüfung als zweckmäßig erachten.
- Für diese Neuvorhaben besteht dann die UVP-Pflicht.
- Die Entscheidung der Behörde ist nicht anfechtbar.
Veranstaltungsempfehlung
Um den gestiegenen Anforderungen an Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte gerecht zu werden, gewinnt neben der Umweltverträglichkeitsprüfung auch eine fundierte Nachhaltigkeitsberichterstattung zunehmend an Bedeutung.
Die Inhouse-Schulung „Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD/ESRS im Unternehmen umsetzen“ bietet praxisnahes Wissen, um diese gesetzlichen Vorgaben systematisch im Unternehmen umzusetzen. Jetzt hier informieren!
Was beinhaltet eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
In erster Linie bezieht sich die UVP auf folgende Schutzgüter gemäß Paragraph 2 Abs. 1 UVPG:- Menschen, bzw. die menschliche Gesundheit
- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
- Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
- kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern
UVP-Bericht: das Kernstück der Prüfung
Der UVP-Bericht nach Paragraph 16 UVPG muss mindestens folgende Angaben enthalten:
- Beschreibung des Vorhabens mit Standort, Art, Umfang und Größe
- Beschreibung der Umwelt im Einwirkungsbereich
- Darstellung der Merkmale zur Vermeidung oder Verminderung negativer Umweltauswirkungen
- Beschreibung geplanter Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung oder zum Ausgleich
- Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen
- Darstellung vernünftiger Alternativen
- allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung
Beteiligte Akteure und Zuständigkeiten
Die Durchführung der UVP obliegt der für die Zulassungsentscheidung zuständigen Behörde. Der Vorhabenträger ist für die Erstellung des UVP-Berichts verantwortlich. Weitere wichtige Akteure sind:
- Fachbehörden (Träger öffentlicher Belange)
- Die Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung)
- Umweltverbände und Bürgerinitiativen
- Nachbargemeinden bei grenzüberschreitenden Auswirkungen
Wie hoch sind die Kosten für eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
Die Kosten einer UVP variieren erheblich je nach Projektumfang und -komplexität. Während die Erstellung des UVP-Berichts vom Vorhabenträger zu finanzieren ist, fallen zusätzlich behördliche Gebühren an.
Behördliche Gebühren
Die behördlichen Gebühren sind in den jeweiligen Kostenverordnungen der Länder und des Bundes geregelt. Exemplarisch zeigen die Kostenordnungen:
- UVP-Zuschlag: 150-175 Prozent der Grundgebühr bei Genehmigungen mit UVP
- Vorprüfungsgebühren: 15 Prozent Zuschlag bei allgemeiner oder standortbezogener Vorprüfung
- Die Gebühren können von einigen hundert Euro bis zu mehreren hunderttausend Euro reichen
Kosten für Gutachten und Fachbeiträge
Die Gutachtenkosten variieren stark nach Vorhaben:
- einfache Umweltgutachten: Ab 500 bis 1.000 Euro
- komplexe UVP-Berichte: Mehrere zehntausend bis hunderttausend Euro
- spezielle Fachgutachten (Fauna, Flora, Lärm, etc.): Je nach Umfang 1.000 bis 10.000 Euro pro Gutachten
Die Gesamtkosten können bei großen Infrastrukturprojekten mehrere hunderttausend Euro erreichen.
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): Verfahrensablauf und Zeitrahmen
Der UVP-Prozess gliedert sich in mehrere Schritte:
- Screening: Feststellung der UVP-Pflicht (6 Wochen)
- Scoping: Festlegung des Untersuchungsrahmens
- Erstellung des UVP-Berichts: Durch den Vorhabenträger
- Behördenbeteiligung: Prüfung durch Fachbehörden
- Öffentlichkeitsbeteiligung: Information und Anhörung der Bürger
- Bewertung: Zusammenfassende Darstellung und begründete Bewertung durch die Behörde
- Entscheidung: Zulassung oder Ablehnung des Vorhabens
Fazit: Umweltverträglichkeitsprüfung als Grundlage für nachhaltige Vorhaben
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein wichtiges Instrument der Umweltvorsorge, das eine systematische und frühzeitige Berücksichtigung von Umweltbelangen in Zulassungsverfahren gewährleistet. Durch die Integration verschiedener Schutzgüter und die Beteiligung aller relevanten Akteure trägt sie zu einer besseren Entscheidungsqualität und höheren Akzeptanz von Vorhaben bei.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens, insbesondere durch die Novellierungen des UVPG, zeigt die Anpassungsfähigkeit des Instruments an neue Herausforderungen wie den Klimawandel und die Energiewende. Für Vorhabenträger ist eine frühzeitige und professionelle Auseinandersetzung mit den UVP-Anforderungen entscheidend für den Projekterfolg.
Quellen: Buzer.de; Bundesanzeiger; Bundesumweltministerium; Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz; Bundesamt für Justiz;