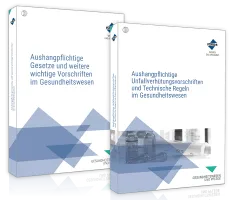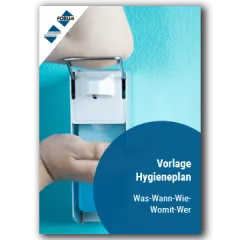Wie funktioniert eine Kompressionstherapie? – Arten, Indikationen und Phasen der Durchführung
29.04.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Ob bei geschwollenen Beinen, Krampfadern oder einem Lipödem – die Kompressionstherapie gehört zu den meistgenutzten Behandlungsformen bei Venenerkrankungen. Allerdings gibt es nicht nur verschiedene Arten und Hilfsmittel, sondern auch unterschiedliche Indikationen und Risiken, die bei der Pflege zu beachten sind. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick für Pflegekräfte und andere Verantwortliche.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist eine Kompressionstherapie und wie funktioniert sie?
- Welche Arten von Kompressionstherapie gibt es?
- Wann wird die Kompressionstherapie genutzt und wann nicht?
- Durchführung der Kompressionstherapie
- Fortbildung für Pflegepersonal
Was ist eine Kompressionstherapie und wie funktioniert sie?
Die Kompressionstherapie ist eine medizinische Behandlungsmethode. Hierbei wird mit elastischen Hilfsmitteln wie Bandagen, Kompressionsstrümpfe oder Wickeln Druck auf bestimmte Venen und das umliegende Gewebe ausgeübt. Das soll den venösen Rückfluss zum Herzen fördern, Ödeme reduzieren und die Durchblutung verbessern. Noch nicht zerstörte Venenklappen können ihre Funktion als Rückstauventil wieder aufnehmen und Schlackenstoffe sowie Metabolite werden abtransportiert.
Meist unterstützt die Therapie bei chronisch-venöser Insuffizienz, Krampfadern, Thrombosen oder nach Operationen. Die eingesetzten Materialien üben Druck auf die betroffenen Areale aus, der deren Gefäße verengt, was wiederum den Blutfluss beschleunigt und die Bildung von Blutgerinnseln verhindern soll. So kommt es zunächst zu einer peripheren Entstauung, bevor im weiteren Therapieverlauf etwaige Ulzerationen abheilen können.
Welche Arten von Kompressionstherapie gibt es?
Die Kompressionstherapie umfasst verschiedene Formen, die sich hinsichtlich Technik, Material und Anwendungszweck unterscheiden.
Zu den häufigsten Methoden gehören:
- Einlagige Kompression: Häufig im klinischen Alltag oder in der Akutversorgung, etwa durch elastische Kurzzugbinden.
- Mehrlagige Kompression: Mehrere Lagen von Binden mit unterschiedlichem Material und Druckprofil.
- Kompressionsstrümpfe: Flach- oder rundgestrickt, verschiedene Kompressionsklassen, für den ambulanten und langfristigen Gebrauch.
- Intermittierende pneumatische Kompressionstherapie: Apparative Therapieform mit aufblasbaren Manschetten, die sequenziell Druck ausüben.
- Adaptive Kompressionssysteme: Variable, wiederverwendbare Bandagen mit Klettverschlüssen.
Wann wird die Kompressionstherapie genutzt und wann nicht? – Indikationen
Für die Kompressionstherapie gelten folgende Indikationen:
| Chronische Venenerkrankungen |
|
| Thromboemblische Venenerkrankungen |
|
Des Weiteren kann die Kompressionsbehandlung unter anderem zur Rezidivprophylaxe oder zur Behandlung von Verbrennungen und Narben beitragen.
Wann darf keine Kompressionstherapie angewendet werden?
Mögliche Kontraindikationen für eine Kompressionstherapie sind:
- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (mindestens einer der folgenden Parameter):
- ABPI unter 0,5
- Knöchelarteriendruck unter 60 mmHg
- Zehendruck unter 30 mmHg
- tcpO2 unter 20 mmHg Fußrücken
- Dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III oder IV)
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit des Kompressionsmaterials
- Schwere Sensibilitätsstörungen der betroffenen Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (etwa bei Diabetes mellitus)
- Primär chronische Polyarthritis
Durchführung der Kompressionstherapie
Für eine erfolgreiche Kompressionstherapie ist es wichtig, eine ausreichende Kompressionsversorgung sicherzustellen.
Als Richtwerte gelten folgende Druckwerte:
| Klasse | Höhe des Blutdrucks | Stärke der Kompression |
| Klasse 1 | 18 bis 20 mmHg | Leichte Kompression |
| Klasse 2 | 20 bis 40 mmHg | Mittlere Kompression |
| Klasse 3 | 40 bis 60 mmHg | Starke Kompression |
| Klasse 4 | mehr als 60 mmHg | Sehr starke Kompression |
Grundsätzlich gliedert sich eine Kompressionstherapie in drei Phasen: die Entstauungsphase, die Erhaltungsphase und die Prävention.
Entstauungsphase
Die Entstauungsphase dauert in der Regel drei bis vier Wochen. In dieser Zeit sollen die Ödeme entstaut und ein stabiler Allgemeinzustand erreicht werden sowie Wunden verheilen. Es kommen Hilfsmittel wie Kurzzugbinden, Fertigbinden-/Mehrkomponentensysteme oder adaptive Kompressionsbandagen zum Einsatz.
Um die Entstauung aufrecht zu halten, reicht in der Regel ein mittlerer Kompressionsgrad aus. Sobald die Entstauung erfolgreich durchgeführt wurde, dürfen Hilfsmittel wie Kompressionsstrümpfe oder andere Ulcus-Strumpfsysteme zum Einsatz kommen.
Erhaltungsphase
In der Erhaltungsphase kommen neben dem Kompressionsstrumpf noch spezielle Unterziehstrümpfe hinzu. Sie dienen als als Fixierung und Schutz des Wundverbandes und können auch nachts getragen werden. Der Kompressionsstrumpf sorgt für die gewünschten Druckverhältnisse – die je nach vorliegender Erkrankung unterschiedlich sein können.
→ Tipp: Die Kompressionstherapie entfaltet ihre volle Wirkung erst unter Bewegung. Daher ist die Einbeziehung der Patientinnen und Patienten entscheidend für den Therapieerfolg. Die behandelnden Fachkräfte sollten auf eine ausreichende Aufklärung der Betroffenen achten. Wo möglich, sind die Betroffenen einzubinden, etwa durch eine Schulung im An- und Ausziehen der Strumpfsysteme. Das erhöht oftmals die Akzeptanz im Vergleich zu Bandagen oder anderen Hilfsmitteln.
Präventionsphase
Sind die Beschwerden abgeheilt oder ist keine Wundversorgung (mehr) nötig, gibt es die Präventionsphase. Hier sollen ausgewählte Hilfsmittel dabei helfen, das (erneute) Aufkommen von Venenerkrankungen oder anderen Indikationen zu vermeiden.
Mögliche Versorgungsoptionen in dieser Phase sind beispielsweise:
- Medizinische Kompressionsstrümpfe (rund- oder flachgestrickt)
- Kompressionsverbände (Wechsel- oder Dauerverbände)
Produktempfehlung
Fertige Pflegeanleitungen zum Anlegen von Kompressionsstrümpfen und -verbänden für Pflegekräfte gibt es in der Software „Pflege- und Expertenstandards“. Darin finden sich noch weitere Checklisten und Dokumentationshilfen für den Arbeitsalltag im Gesundheitswesen. Jetzt informieren!
Fortbildung zur Kompressionstherapie
Wie in den meisten medizinischen Bereichen gibt es auch bei der Kompressionstherapie regelmäßig neue Erkenntnisse. Das kann etwa die Behandlungsmethoden oder die Wundhygiene betreffen. Damit sich Pflegekräfte und andere medizinische Angestellte auf dem aktuellsten Stand halten, gibt es passende Weiterbildungsangebote rund um die Wundversorgung. So können sie ihren Kompetenzbereich langfristig erweitern.
Quelle: E-Learning „DEKRA-zertifizierte/r Wundexperte/-expertin“