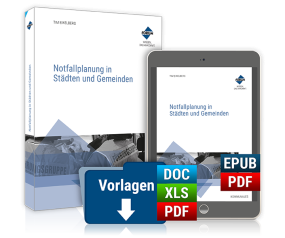Hitzeschutz in Kommunen: Effektive Strategien & erprobte Maßnahmen gegen Extremhitze
25.07.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Der Klimawandel verändert das Stadtklima spürbar. Längere Hitzewellen, Tropennächte und steigende Durchschnittstemperaturen führen nicht nur zu sinkendem Wohlbefinden, sondern bergen auch ernsthafte Gesundheitsrisiken – insbesondere für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke sowie Menschen in dicht besiedelten Quartieren. Kommunen stehen daher vor der dringenden Aufgabe, strukturelle, planerische und organisatorische Maßnahmen zum Hitzeschutz zu ergreifen. Dieser Fachbeitrag erklärt effektive Maßnahmen zum Hitzeschutz, Praxisbeispiele und Kosten – so schützen Kommunen und Städte ihre Bürger nachhaltig vor Extremhitze.
Inhaltsverzeichnis
- Warum Hitzeschutz in Kommunen immer wichtiger wird
- Maßnahmen gegen Hitze in Städten
- Kommunale Hitzeschutzkonzepte und Hitzeaktionspläne
- Praxisbeispiele für Hitzeschutz: erste Kommunen gehen voran
- Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Hitzeschutz in Kommunen
- Fazit: Hitzeschutz ist Pflichtaufgabe der Zukunft
Warum Hitzeschutz in Kommunen immer wichtiger wird
Die Daten sprechen eine klare Sprache: Während es in den 1960er-Jahren durchschnittlich vier heiße Tage (≥30 °C) pro Jahr gab, liegt dieser Wert inzwischen bei über elf. Studien des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) belegen die gesundheitlichen Auswirkungen: Hitzestress kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dehydrierung oder gar Todesfällen führen. Die Stadtstruktur selbst verschärft das Problem durch sogenannte Wärmeinseln – städtische Hotspots, in denen die Temperaturen bis zu 8 °C über denen des Umlands liegen.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Hitzeschutz nicht nur ein Klimathema ist, sondern ein zentrales Element der kommunalen Daseinsvorsorge auch mit Blick auf die Waldbrandgefahr. Wie der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) betont, ist die Hitzeaktionsplanung ein zentraler Baustein für den Schutz der öffentlichen Gesundheit – vergleichbar mit Katastrophen-, Infektions- oder Zivilschutzplänen.
Maßnahmen gegen Hitze in Städten
Bewährte Maßnahmen zum Hitzeschutz zielen auf Kühlung und Schatten in der Stadt ab. Typische Beispiele sind:
- Straßenbäume und Grünflächen: Stadtbäume, Parkanlagen, Fassaden- und Dachbegrünung spenden Schatten und fördern Verdunstungskühlung – ein natürlicher Temperaturpuffer.
- Wasserangebote und blaue-grüne Infrastruktur: Öffentliche Trinkbrunnen, Sprinkler- und Nebelduschen sowie Teiche oder Brunnenanlagen erzeugen durch Verdunstung Kühle. In öffentlichen Gebäuden können Wasserwände oder feuchte Tücher kurzfristig die Temperatur senken.
- Frischluftschneisen und Entsiegelung: Grüne Korridore („Kaltluftschneisen“) in der Stadt und die Entsiegelung von Flächen (Schwammstadt-Ansatz) ermöglichen kühlende Luftströme von den Randbereichen ins Zentrum. Langfristig entlasten lockere Bebauung und unterirdische Wasserspeicher das Stadtklima.
- Helle und reflektierende Oberflächen: Helle Fassadenanstriche, helle Dachmaterialien und Straßenbeläge absorbieren weniger Sonnenwärme. Studien empfehlen deshalb die Nutzung heller Farben bei Neubauten und Sanierungen.
- Warnsysteme und Kommunikation: Klimaanzeigegeräte, Hitze-Apps und der DWD-Hitzewarner informieren Bürger*innen und Behörden in Echtzeit über Gefahrenstufen. Gezielt gewarnt werden müssen besonders gefährdete Gruppen (wie Senioren, Kinder und Kranke) sowie Betreuer in Pflegeheimen und Schulen. Aufklärungskampagnen (zum Beispiel „Hitzetipps“ des Bundesministerium für Gesundheit) und Schulungen für Pflegekräfte erhöhen die Wahrnehmung und das Schutzverhalten der Bevölkerung.
Hitzeaktionspläne: Koordination und Vorsorge im Fokus
Zunehmend erkennen Kommunen, dass Einzelmaßnahmen nicht ausreichen. Gefordert ist ein strukturierter Hitzeaktionsplan (HAP), der konkrete Vorsorge- und Notfallmaßnahmen strategisch bündelt und die Akteure vernetzt. Laut VDI und Bundesumweltministerium sind HAPs das zentrale Instrument der kommunalen Hitzevorsorge. Sie ermöglichen:
- frühzeitige Reaktion auf bevorstehende Hitzewellen
- klare Zuständigkeiten und Abläufe bei Warnung, Versorgung und Betreuung
- interdisziplinäre Zusammenarbeit von Gesundheitsamt, Stadtplanung, Katastrophenschutz und sozialen Trägern
- Schutz vulnerabler Gruppen, insbesondere in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kindergärten
- Integration baulicher Anpassungen in Bebauungspläne und Stadtentwicklung
Die Erstellung eines HAP folgt in der Regel einem Stufenmodell (zum Beispiel nach BMUV), das eine zentrale Steuerung, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit und physische Schutzmaßnahmen kombiniert. Dabei spielt auch die ingenieurtechnische Perspektive eine zunehmende Rolle – so etwa in der Bewertung mikroklimatischer Auswirkungen baulicher Maßnahmen oder bei der Auswahl geeigneter Baumaterialien mit günstigen Reflexions- und Wärmeleitfähigkeiten.
Produktempfehlung
Um Kommunen wirksam auf zunehmende Extremwetterereignisse wie Hitzewellen vorzubereiten, braucht es neben kurzfristigen Schutzmaßnahmen eine strukturierte Krisenvorsorge.
Eine wertvolle Unterstützung bietet hierbei der Praxisleitfaden „Notfallplanung in Städten und Gemeinden“ mit praxiserprobten Strategien und Checklisten für den Ernstfall.
Praxisbeispiele für Hitzeschutz: erste Kommunen gehen voran
Zahlreiche Städte haben bereits HAPs eingeführt, darunter Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Mannheim oder die Landkreise Ludwigsburg und Enzkreis. In Köln flossen beispielsweise rund 300.000 Euro in die Konzeption, Kommunikation und Personalstellen des lokalen Hitzeschutzprojekts. Die Mittel stammen überwiegend aus Bundes- und Landesförderprogrammen zur Klimaanpassung.
Doch nicht jede Kommune verfügt über dieselben Ressourcen. Kleinere Städte setzen daher auf „Light-Versionen“ von Hitzeaktionsplänen – mit einem schrittweisen Ausbau. Die größten Kostenblöcke liegen meist im Personalaufwand. Laufende Maßnahmen wie zusätzliche Wasserversorgung oder Sommerdienste verursachen weitere Betriebskosten. Langfristig stehen diese jedoch in einem sinnvollen Verhältnis zu den Folgekosten unbehandelter Hitzebelastungen – etwa durch Krankheitsfälle, Infrastrukturüberlastung oder Arbeitsausfall.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Hitzeschutz in Kommunen
- Welche Städte haben bereits Hitzeaktionspläne? Beispiele sind Köln, Düsseldorf, Mannheim, Karlsruhe, sowie zahlreiche Landkreise in Baden-Württemberg.
- Wie funktioniert ein Hitzewarnsystem? Das System basiert auf Temperaturprognosen des DWD. Bei Überschreitung bestimmter Schwellen werden Behörden, Pflegeeinrichtungen und Bürger per App oder E-Mail gewarnt.
- Wie viel kostet ein kommunaler Hitzeaktionsplan? Je nach Umfang zwischen 100.000 und 400.000 Euro. Die laufenden Kosten variieren je nach Maßnahmenpaket.
- Wer trägt die Verantwortung auf kommunaler Ebene? Die Koordination liegt meist bei Umwelt- oder Gesundheitsämtern. Wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller relevanten Ressorts.
- Gibt es Förderprogramme für Hitzeschutz? Ja. Das Bundesumweltministerium, die Länder sowie EU-Programme fördern kommunale Klimaanpassungsvorhaben inklusive Hitzeschutz.
- Welche Rolle spielt die Bevölkerung im Hitzeschutz? Eine zentrale: Nur wenn Bürger informiert und vorbereitet sind, greifen Maßnahmen. Beteiligung, Aufklärung und Eigenverantwortung sind Schlüsselfaktoren.
Fazit: Hitzeschutz ist Pflichtaufgabe der Zukunft
Angesichts des demografischen Wandels, zunehmender Urbanisierung und des Klimawandels ist Hitzeschutz keine freiwillige Zusatzleistung mehr, sondern eine Pflichtaufgabe kommunaler Gesundheits- und Stadtplanung. Kommunen benötigen klare Konzepte, technisches Know-how und politische Rückendeckung, um ihre Infrastruktur und Bevölkerung widerstandsfähig gegen Extremtemperaturen zu machen.
Ein wirksamer Hitzeaktionsplan schützt nicht nur Leben, sondern wirkt langfristig auch kostenmindernd und ressourcenschonend. Städte und Gemeinden sind daher gut beraten, jetzt zu handeln – bevor der nächste heiße Sommer kommt.
Quellen: Umweltbundesamt; „Die neue Arbeitsstättenverordnung“; „Notfallplanung in Städten und Gemeinden“; Deutscher Wetterdienst; Deutsches Institut für Urbanistik; Bundesministerium für Gesundheit;