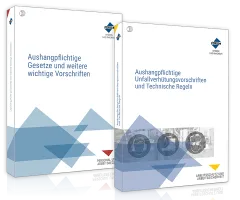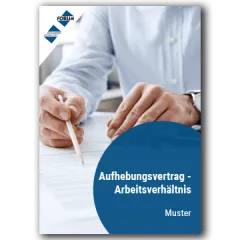Kündigungsgründe Arbeitgeber: Beispiele und gesetzliche Grundlagen
12.11.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Arbeitgeber können aus unterschiedlichsten Gründen eine Kündigung aussprechen, sei es personen-, verhaltens- oder betriebsbedingt. Doch nicht alle Begründungen sind arbeitsrechtlich zulässig. Der folgende Beitrag zeigt die wichtigsten Kündigungsgründe für Arbeitgeber, erklärt die gesetzlichen Hintergründe und erläutert, wann Arbeitgeber den Kündigungsgrund angeben müssen – und wann nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Welche Kündigungsgründe gibt es für Arbeitgeber? – Beispiele
- Häufigste Kündigungsgründe von Arbeitgebern in Deutschland – Statistik
- Wann muss der Arbeitgeber den Kündigungsgrund nennen?
- Wann darf ein Arbeitgeber ohne Grund kündigen?
- Fazit
Welche Kündigungsgründe gibt es für Arbeitgeber? – Beispiele
In Deutschland kann ein Arbeitsverhältnis durch eine ordentliche, einer außerordentliche oder eine Änderungskündigung aufgelöst werden. Bei einer Änderungskündigung wird ein bestehender Arbeitsvertrag angepasst und durch einen neuen ersetzt. Somit beginnt unmittelbar ein neues Arbeitsverhältnis.
Bei einer (außer-)ordentlichen Kündigung hingegen endet das Verhältnis endgültig. Deshalb lassen sich Kündigungsgründe meist einer dieser beiden Kündigungsformen zuordnen.
Gründe für ordentliche Kündigung (§ 622 BGB)
Bei einer ordentlichen Kündigung ist die entsprechende Kündigungsfrist (gesetzlich, tariflich oder vertraglich geregelt) einzuhalten. Außerdem ist ein sozial gerechtfertigter Kündigungsgrund erforderlich.
Diese sozialen Rechtfertigungen sind in drei Hauptgruppen unterteilt und zeigen, welche Kündigungsgründe für Arbeitgeber möglich sind:
| Kündigungsgrund | Definition | Beispiele |
| Personenbedingt | Mitarbeitende können aufgrund persönlicher Ursachen ihre vertraglichen Pflichten nicht (mehr) erfüllen. |
|
| Verhaltensbedingt | Angestellte verstoßen schuldhaft gegen arbeitsvertragliche Pflichten und beeinträchtigen so das Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber erheblich. |
|
| Betriebsbedingt | Der Arbeitgeber kann die Angestellten aus betrieblichen Gründen nicht weiter beschäftigen, oftmals aufgrund wirtschaftlicher Engpässe oder Umstrukturierungen. |
|
Je nach Vorfall können einige der oben genannten Kündigungsgründe auch eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen – das gilt auch für unbefristete Verträge.
Gründe für außerordentliche Kündigung (§ 626 BGB)
Eine außerordentliche Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis sofort, also ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Hierfür muss ein wichtiger Grund vorliegen, der es dem Arbeitgeber unzumutbar macht, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist fortzusetzen. Die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes erklärt werden (§ 626 Absatz 2 BGB).
Mögliche außerordentliche Kündigungsgründe von Arbeitgebern sind in der Regel verhaltensbedingt, da nur ein gravierendes Fehlverhalten die sofortige Beendigung rechtfertigt.
Solch schwerwiegendes Fehlverhalten kann zum Beispiel sein:
- Diebstahl
- Schwere Beleidigung
- Mobbing
- Diskriminierung
- Sexuelle Belästigung
- Arbeitszeitbetrug
- Weitergabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen
Betriebsbedingte Gründe kommen für außerordentliche Kündigungen nicht in Betracht, da sie regelmäßig vorhersehbar sind und keine Unzumutbarkeit im Sinn des § 626 BGB Absatz 1 darstellen.
→ Generell kommt eine außerordentliche Kündigungen nur ausnahmsweise in Betracht und erfordert, je nach Schwere der Verfehlung, eine vorherige Abmahnung.
Sonstige Kündigungsgründe von Arbeitgebern
Neben den bereits genannten Motiven können noch folgende Beendigungstatbestände infrage kommen:
- Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch das Arbeitsgericht
- Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses ohne anschließende Festanstellung
- Beschäftigte Person verweigert Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Feststellung einer unwirksamen Kündigung (§§ 12, 16 KSchG)
- Vorläufige Einstellung ohne Zustimmung des Betriebsrats (§§ 100, 101 BetrVG)
- Einseitige Lossagung vom faktischen Arbeitsverhältnis
- Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
- Anfechtung eines Arbeitsverhältnisses wegen Irrtums, falscher Übermittlung oder Täuschung/Drohung (§§ 119, 120, 123 BGB)
- Tod der angestellten Person
Ungültige Kündigungsgründe
Keine Beendigungstatbeständige und damit keine Kündigungsgründe sind nach deutschem Arbeitsrecht:
- Tod des Arbeitgebers
- Veräußerung des Betriebs (Betriebsübergang nach § 613a BGB)
- Insolvenz des Arbeitgebers oder Stilllegung
- Einberufung zum Wehrdienst, zur Eignungsübung oder zum zivilen Ersatzdienst
Arbeitgeber sollten sich demnach mit den geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen zur Trennung von Arbeitnehmenden auskennen.
Häufigste Kündigungsgründe von Arbeitgebern in Deutschland – Statistik
Bisher gibt es nur wenige Statistiken, die die Kündigungsgründe von Arbeitgebern in Deutschland analysieren. In diesem Zusammenhang wird häufig auf eine Untersuchung der ehemaligen Kanzlei „Heisse Kursawe Eversheds“ von 2014 verwiesen. In dieser wurden insgesamt 512 Kündigungsverfahren von 380 Unternehmen untersucht.
Die häufigsten Kündigungsarten der untersuchten Arbeitgeber waren demnach:
- Betriebsbedingte Kündigung (73,2 Prozent)
- Verhaltensbedingte Kündigung (24,4 Prozent)
- Personenbedingte Kündigung (2,4 Prozent)
Die Autorinnen und Autoren vermuten bei ihrer Auswertung, dass ein Teil der verhaltens- oder personenbedingten Kündigungen als betriebsbedingt „getarnt“ ist, da solche Kündigungen für die Unternehmen angenehmer zu führen sein.
Die meisten anderen Statistiken untersuchen vorrangig die Kündigungsgründe von Arbeitnehmenden.
Warum kündigen Arbeitnehmende?
In einer Umfrage der Beratungsfirma „McKinsey & Company“ von 2022 nannten die Beschäftigten am häufigsten eine unzureichende Vergütung (39 Prozent), die Unzufriedenheit mit Führungskräften (36 Prozent) und einen Mangel an beruflicher Entwicklung und Beförderung (34 Prozent) als Kündigungsgründe.
Diese Zahlen spiegeln sich in Teilen auch in einer Studie des Jobportals „Stepstone“ aus dem Jahr 2024 wider. Dort waren die häufigsten Kündigungsgründe der Mitarbeitenden:
- Geringe Bezahlung (49 Prozent)
- Hohe Arbeitsbelastung (34,3 Prozent)
- Allgemeine Unzufriedenheit (32,6 Prozent)
- Neues Jobangebot (28,9 Prozent)
- Umstrukturierung des Teams (23 Prozent)
- Geänderte Führungsebene (20,8 Prozent)
- Fehlende Aufstiegsmöglichkeiten (20,5 Prozent)
Doch wenn die Kündigung vom Arbeitgeber ausgeht, wann muss dieser überhaupt einen Grund angeben?
Wann muss der Arbeitgeber den Kündigungsgrund nennen?
Bei ordentlichen Kündigungen muss der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben keinen Grund angeben. Das gilt auch bei außerordentlichen Kündigungen, da der Kündigungsgrund hier nur auf Verlangen des Arbeitnehmers schriftlich mitzuteilen ist (§ 626 Absatz 2 BGB). Ebenso ist bei Kündigungen in der Probezeit oder mit Auslauf eines befristeten Verhältnisses kein schriftlicher Kündigungsgrund erforderlich. Nach § 623 BGB ist lediglich die Schriftform vorgeschrieben, nicht der Grund.
In folgenden Fällen muss der Arbeitgeber seinen Kündigungsgrund jedoch nennen:
- Angestellte erhalten im Rahmen der Anhörung des Betriebsrats Einsicht in die Kündigungsgründe (§ 102 BetrVG).
- Im Zuge einer außerordentlichen Kündigung verlangt die/der Angestellte, den Grund zu erfahren.
- Die Kündigung erfolgt während der Schwangerschaft, Elternzeit oder gegenüber einer schwerbehinderten Person – hier bedarf es der Zustimmung der zuständigen Behörde mit konkreter Begründung (§ 17 MuSchG, § 18 BEEG, § 168 SGB IX).
- Eine spezielle Vereinbarung in Tarifvertrag, Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung verpflichtet zur Angabe des Kündigungsgrunds.
In der Praxis sollten Arbeitgeber den Kündigungsgrund im Rahmen der internen Dokumentation klar festhalten. Damit können sie im Streitfall vor dem Arbeitsgericht eine nachvollziehbare Begründung vorlegen.
Wann darf ein Arbeitgeber ohne Grund kündigen?
In Deutschland müssen Arbeitgeber keinen Kündigungsgrund angeben, wenn das Arbeitsverhältnis nicht unter das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) fällt. Das ist der Fall, wenn der Betrieb weniger als zehn Mitarbeitende beschäftigt (sogenannter Kleinbetrieb, § 23 Absatz 1 KSchG) oder das Arbeitsverhältnis weniger als sechs Monate besteht, etwa in der Probezeit (§ 1 Absatz 1 KSchG). Bei länger bestehenden Verhältnissen oder unbefristeten Verträgen kann der Kündigungsgrund hingegen eine bedeutsame Rolle spielen.
Hinweis: Eine Kündigung „ohne Grund“ darf dennoch nicht willkürlich, diskriminierend oder sittenwidrig sein. Unternehmen sollten bei vermeintlich „freien“ Kündigungen ihre Entscheidung sorgfältig abwägen, da Arbeitsgerichte Kündigungen bei erkennbar sachfremden Motiven als rechtswidrig einstufen können.
Fazit
Die Kündigungsgründe von Arbeitgebern sind in Deutschland klar gesetzlich geregelt und erfordern eine sorgfältige Prüfung. Personen-, verhaltens- und betriebsbedingte Gründe bilden das Kernsystem des Kündigungsschutzes und erfolgen meist als ordentliche Kündigung. Außerordentliche Kündigungen sind die Ausnahme und nur bei besonders schwerwiegendem Verhalten der Mitarbeitenden zulässig. Ereignisse wie der Tod des Arbeitgebers oder ein Insolvenzverfahren des Unternehmens gelten nicht als Kündigungsgrund.
Arbeitgeber sollten vor jeder Kündigung prüfen, ob der gewählte Grund sozial gerechtfertigt, intern dokumentiert und formell korrekt ist. Eine fundierte Vorbereitung mit den arbeitsrechtlichen Grundlagen reduziert das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen.
→ Entsprechende Arbeitshilfen zeigen, welche arbeitsrechtlichen Vorgaben Unternehmen bei der Kündigung beachten sollten.
Produktempfelhung
Die „Arbeitgebermappe Trennungsmanagement“ besteht aus zahlreichen Checklisten, Musterschreiben und Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Kündigungsgründen und Trennungsarten.
Noch mehr interaktiven Input gibt es im Online-Live-Seminar „Professionelles Trennungsmanagement: Risiken minimieren, Handlungssicherheit gewinnen“. Jetzt informieren!
Quelle: „Arbeitgebermappe Trennungsmanagement“