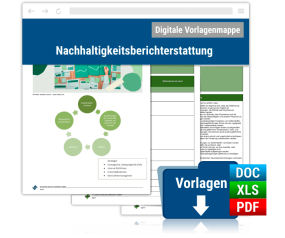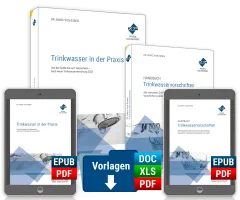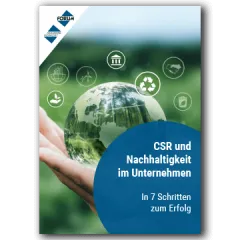EU-Taxonomie: ein Rahmen für nachhaltige Investitionen
15.07.2025 | J. Morelli/S. Horsch – Online Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Die EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 definiert nachhaltiges Wirtschaften und ist zentrales Instrument zur Förderung nachhaltiger Investitionen innerhalb der Europäischen Union. Sie stellt sicher, dass Unternehmen anhand harmonisierter Nachhaltigkeitsberichterstattung transparent für Investitionsmittel werden, die den Umweltzielen der EU entsprechen – und verhindert dadurch sogenanntes Greenwashing. In unserem Fachartikel haben wir für Sie die Hintergründe, Inhalte und Auswirkungen auf Unternehmen zusammengefasst und zeigen zudem, was sich durch die am 4. Juli 2025 verabschiedete Delegierte Verordnung zur Überarbeitung der Taxonomieverordnung ändern soll.
Inhaltsverzeichnis
- EU-Taxonomie: Hintergrund
- Taxonomischer Kerngedanken: Nachhaltigkeit
- Ziele der EU-Taxonomie
- Die jüngsten Anpassungen der EU-Taxonomie von Juli 2025
- Umsetzung und Auswirkungen – Pflicht für Unternehmen?
- Fazit
EU-Taxonomie: Hintergrund
Die Verordnung wurde im Juni 2020 verabschiedet, am 6. Juli 2021 veröffentlicht, ist seit dem 1. Januar 2022 gültig und baut auf bestehenden EU-Richtlinien zur nachhaltigen Entwicklung auf. Am 4. Juli 2025 hat die Europäische Kommission eine weitere Delegierte Verordnung zur Taxonomie-Verordnung angenommen.
Sie ist Teil des umfassenden europäischen Grünen Deals (Green Deal), der darauf abzielt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Dabei sollen durch die Standardisierung nachhaltiger Messgrößen Unternehmen und deren Wirtschaftsweise transparenter und gleichzeitig lukrativer für Zukunftsinvestitionen gemacht werden. Ihr Schwerpunkt liegt dabei klar auf der praxisnahen Umsetzung des European Green Deal.
→ Anhand der EU-Taxonomie sollen Wirtschaftsaktivitäten auf deren Nachhaltigkeit überprüft und entsprechend eingestuft werden.
Taxonomischer Kerngedanke: Nachhaltigkeit
Eines der Ziele der EU-Taxonomie ist es demnach, nachhaltige Unternehmen durch öffentliche und private Investitionen zu unterstützen und somit als Katalysator für die bis 2050 geplante europäische Klimaneutralität dienen. Im Gegensatz zu diesem mittel-bis langfristigen Ziel, soll die EU-Taxonomie-Verordnung auch dazu führen, dass das Ziel des sog. „Fit for 55“-Maßnahmenpakets der EU erreicht wird – 55 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030. Vor allem dieser Punkt stieß seit Veröffentlichung der Verordnung auf teils starke Skepsis seitens der deutschen Industrie. Denn klar dabei schien den Vertretern unterschiedlicher Branchen zu sein, dass primär in privatwirtschaftliche Vorleistung gegangen werden müsste, bevor zusätzliche grüne Investitionen durch externe Quellen fließen würden.
Exkurs: Was wird eigentlich unter Taxonomie im europäischen Kontext verstanden?
Taxonomie wörtlich übersetzt bedeutet „gesetzliche Ordnung“ und tritt als Bezeichnung in unterschiedlichen wissenschaftlichen Feldern auf (z. B. in der Biologie). Im Rahmen des Green Deals erlangte der Ausdruck jedoch eine „grüne“ Konnotation und ist seit einigen Jahren fest mit der eu-weiten Klassifizierung von Nachhaltigkeitsreporting, Wirtschaftsaktivitäten und grünen Investitionen verbunden.
Alleinstehend beinhaltet die EU-Taxonomie-Verordnung die Grundlage dafür, in welchem Rahmen und auf welche Art und Weise Nachhaltigkeitskennzahlen erhoben sowie analysiert werden. Auf ihr aufbauend bilden die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und ESRS (European Sustainability Reporting Standards) die harmonisierten Regelwerke, nach welchen in der Praxis Green Reporting vonstattengehen soll.
→ Mit ihren Inhalten und Zielen stellt die EU-Taxonomie-Verordnung eine Weiterentwicklung der Inhalte des Kyoto-Protokolls und des Pariser Klimaabkommens dar.
Ziele der EU-Taxonomie
- Klimaschutz: Reduzierung der Treibhausgasemissionen – auf nationaler Ebene ist es beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz (GEG), dass dafür sorgen soll, dass der deutsche Gebäudebestand in Etappen bis 2050 klimaneutral wird.
- Klimaanpassung: Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel – dieser Punkt betrifft u. a. Energieversorgung, Bausektor, Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätswende.
- Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen: Wasserverbrauch und Wasserqualität sind Kernbestandteile der neuen Trinkwasserverordnung und sollen dazu führen, dass Trinkwasserreservoirs und allgemein Grundwasserbestände geschont werden – bei Wasserrecycling wird vor allem auf das Grau- und Regenwassermanagement geblickt.
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: Förderung von Recycling und Ressourceneffizienz (Cradle-to-Cradle, Stoffkreisläufe, Recycling-Baustoffe).
- Vermeidung von Umweltverschmutzung: Abfallverordnung, Entsorgungsrichtlinien etc.
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität: z. B. durch Ausgleichsflächen, geschützte Grünanlagen sowie Artenschutz- und pflege.
Mit Inkrafttreten der EU-Taxonomie waren zum 1. Januar 2022 nur die ersten beiden Ziele relevant: Klimaschutz und Klimaanpassung. Seit dem 1. Januar 2023 finden jedoch auch die nachhaltige Wassernutzung, Kreislaufwirtschaft, Reduzierung und Vermeidung von Umweltverschmutzungen und die Biodiversität erhaltende oder fördernde Maßnahmen als Nachhaltigkeitskennzahlen Anwendung.
Veranstaltungsempfehlung
Wer sich mit den Anforderungen der EU-Taxonomie auseinandersetzt, steht schnell vor komplexen Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Vertiefendes Praxiswissen hierzu bietet die Inhouse-Schulung „Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD/ESRS im Unternehmen umsetzen“, das Sie optimal auf die Umsetzung vorbereitet. Sichern Sie sich jetzt hier einen der begehrten Plätze!
Kriterien für Nachhaltigkeit – welche Wirtschaftsaktivitäten gelten als ökologisch nachhaltig?
Die EU-Taxonomie definiert klare Kriterien, die wirtschaftliche Aktivitäten erfüllen müssen, um als ökologisch nachhaltig eingestuft zu werden. Diese Kriterien sollen Transparenz schaffen und Investoren dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wirtschaftsaktivitäten sind dann ökologisch nachhaltig, wenn alle der folgenden Kriterien zutreffen:
- sie zu einem der sechs genannten Umweltzielen beitragen,
- durch sie keines der sechs Umweltziele beeinträchtig wird,
- sie einen Mindestschutz i. S. d. Umweltziele bewerkstelligen,
- gleichzeitig den technisch festgelegten Bewertungskriterien nachkommen.
Die jüngsten Anpassungen der EU-Taxonomie von Juli 2025
Um den Verwaltungsaufwand für Unternehmen weiter zu reduzieren und die Umsetzung zu vereinfachen, hat die Europäische Kommission am 4. Juli 2025 eine Delegierte Verordnung zur Überarbeitung der Taxonomieverordnung verabschiedet. Die wichtigsten Änderungen sind im Überblick:
- Wesentlichkeitsschwellen: Wirtschaftliche Aktivitäten, die weniger als 10 Prozent der Gesamterlöse, CapEx oder OpEx eines Unternehmens ausmachen, müssen nicht mehr taxonomiekonform deklariert werden.
- Berichtspflichten: Nicht-Finanzunternehmen werden von der Verpflichtung entlastet, sämtliche Betriebsausgaben bei der Taxonomie-Bewertung zu berücksichtigen, sofern diese als unwesentlich gelten.
- Vereinfachte Vorlagen: Die Zahl der abzugebenden Datenpunkte wurde um bis zu zwei Drittel verringert.
- Neue Regeln für Finanzunternehmen: Diese dürfen zwei Jahre lang auf die Offenlegung spezifischer Kennzahlen, beispielsweise der Green Asset Ratio, verzichten.
- Anpassungen der Umweltkriterien: Das „Do No Significant Harm“-Prinzip wurde vereinfacht. Es besagt, dass wirtschaftliche Aktivitäten keine erheblichen negativen Auswirkungen auf Umweltziele haben dürfen. mit der Aktualisierung von 2025 wurden die Anforderungen an den Nachweis reduziert und teilweise pauschale Annahmen eingeführt. So müssen Unternehmen nun weniger umfassende Prüfungen durchführen, wenn ihre Tätigkeiten als „niedriges Risiko“ eingestuft werden.
- Kriterien für Immobilien: Für Bestandsgebäude reicht nun ein Nachweis, zu den 15 Prozent energieeffizientesten Gebäuden zu zählen. Für Neubauten wurde die Anforderung auf einen um 10 Prozent besseren Primärenergiebedarf gegenüber nationalen Niedrigenergie-Gebäude-Standards abgesenkt.
Umsetzung und Auswirkungen – Pflicht für Unternehmen?
Die Verordnung verpflichtet Finanzmarktteilnehmer und Unternehmen zur Offenlegung, wie ihre Investitionen und Geschäftsaktivitäten zur Erreichung der Umweltziele beitragen. Dies fördert die Transparenz und reduziert das Risiko von Greenwashing, bei dem Produkte fälschlicherweise als umweltfreundlich dargestellt werden.
Dabei ist die EU Taxonomie nur für Unternehmen verpflichtend, die unter die NFRD/CSRD fallen.Das beinhaltet seit dem Geschäftsjahr 2023 auch KMU, die folgende Charakteristika aufweisen:
- 20 Mio. Bilanzsumme
- 40. Mio Umsatz
- Weniger als 250 Beschäftigte
Fazit
Die EU-Taxonomie ist ein entscheidendes Werkzeug zur Förderung nachhaltiger Investitionen und zur Erreichung der EU-Umweltziele. Durch klare Kriterien und Transparenzvorgaben leistet sie einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Europa.
Dennoch stellt sie mit ihren 6 Grundanforderungen teils große Hürden für Unternehmen dar. Um als nachhaltig kategorisiert zu werden, müssten viele Unternehmen eine nicht unerhebliche Anfangsinvestition in Kauf nehmen. Jedoch würde sich diese im Laufe der nächsten Jahre schnell amortisieren, da Nachhaltigkeit bereits jetzt ein Verkaufsargument oder in manchen Branchen gar Unique Selling Point (USP) darstellt.
Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass sich im Laufe der nächsten Jahre Sanktionen gegen nicht nachhaltig wirtschaftende Unternehmen verschärfen werden. Somit wäre eine Investition in die eigene Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung gleich im doppelten Sinne eine Zukunftsinvestition.
Quellen: Verordnung (EU) 2020/852, https://www.bmuv.de/faq/was-ist-die-taxonomie, „GEG Baupraxis“