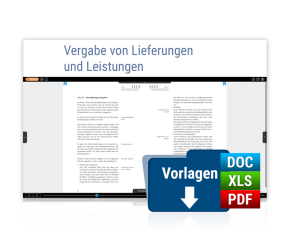E-Vergabe: Regelungen zur elektronischen Vergabe oberhalb und unterhalb des EU-Schwellenwerts
27.07.2023 | J. Morelli – Online-Redaktion, Forum Verlag Herkert GmbH

Spätestens seit dem 18. April 2017 ist das elektronische Vergabeverfahren für EU-weite Ausschreibungen für zentrale Beschaffungsstellen Pflicht. Im Unterschwellenbereich müssen zudem spätestens ab 1. Januar 2020 alle Teilnahmeanträge über elektronische Mittel eingereicht werden. Aber was passiert, wenn Kommunale-Ausschreibungen keinen online-Abnehmer finden und wie stellen sich Feuerwehren und Bauhöfe vergabetechnisch richtig auf?
Inhaltsverzeichnis
- E-Vergabe ist seit 2018 verpflichtend
- E-Vergabe oberhalb des EU-Schwellenwerts
- E-Vergabe unterhalb des EU-Schwellenwerts
- E-Vergabe: Ziele und noch offene Herausforderungen
- E-Forms werden ab Oktober 2023 zum europaweiten Standard
- E-Vergabe für Feuerwehr und Bauhof oder doch lieber analog?
E-Vergabe ist seit 2018 verpflichtend
Während die E-Vergabe früher eine optionale Regelung war, ist sie seit dem 26. Februar 2014 in der europäischen Richtlinie 2014/24/EU verbindlich vorgeschrieben. Bis zum 18. April 2016 musste die EU-Richtlinie daraufhin in nationales Recht umgesetzt werden – mit diesem Tag sind die Regelungen in Deutschland in Kraft getreten.
Allerdings gab es eine Übergangsfrist von 30 Monaten, sodass die Regelungen für alle Auftraggeber ab dem 18. Oktober 2018 verpflichtend wurden.
E-Vergabe oberhalb des EU-Schwellenwerts
Für Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwerts gelten das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV). Demnach müssen elektronische Mittel für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten gemäß § 97 Abs. 5 (GWB) verwendet werden. Sowohl der öffentliche Auftraggeber als auch der Bewerber müssen sich unabhängig von der Art des Auftragsgegenstandes verpflichtend an diese Vorgaben bei der (E-)Vergabe halten.
→ Die von dieser Regelung betroffene elektronische Kommunikation umfasst
- die elektronische Erstellung und Bereitstellung der Auftragsbekanntmachung,
- die kostenlose Bereitstellung der elektronischen Vergabeunterlagen insbesondere der Leistungsbeschreibung,
- die Abgabe und Entgegennahme elektronischer Angebote sowie
- den Austausch von Informationen im Vergabeverfahren.
Dabei müssen die öffentlichen Auftraggeber ein elektronisches Kommunikationsmittel nutzen, das keine diskriminierenden Inhalte darstellt, allgemein verfügbar ist, mit der gängigen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) kompatibel ist und keine Zugangseinschränkungen zum Vergabeverfahren vorsieht. Dieses elektronische Mittel muss außerdem auf dem neuesten Stand der Technik sein, um die Unversehrtheit, Vertraulichkeit und Echtheit der Daten gewährleisten zu können.
Abwicklung interner Prozesse
Die Regelungen zur elektronischen Datenübermittlung betreffen lediglich die Kommunikation zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Unternehmen im Vergabeverfahren, jedoch nicht die Abwicklung interner Arbeitsabläufe. Es ist dem Auftraggeber selbst überlassen, ob er für die Prozesse vor und nach dem Vergabeverfahren z. B. ein Vergabemanagementsystem nutzt. Da es keine Vorgaben hinsichtlich dieser Prozesse gibt, könnte er sie auch in Papierform vornehmen.
Detailliertes Wissen zur verpflichtenden elektronischen Kommunikation finden Sie im Werk „Das neue Vergaberecht“. Es umfasst neben allen gesetzlichen Regelungen zum Vergaberecht auch die Anforderungen an die Benutzung von elektronischen Vergabe-Plattformen, über die Vergabeverfahren vollständig elektronisch abgewickelt werden können.
E-Vergabe unterhalb des EU-Schwellenwerts
Auch die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), die am 2. September 2017 in Kraft getreten ist, enthält Regelungen zur E-Vergabe. Sie besagt, dass Auftraggeber künftig öffentliche Aufträge immer auch im Internet veröffentlichen müssen (§ 28 UVgO). Dazu gehört auch digitale und kostenfreie Bereitstellung von Vergabeunterlagen (§ 29 UVgO).
Wichtig: Ab dem 1. Januar 2020 können Bewerber und Bieter zudem ihre Teilnahmeanträge und Angebote nur noch elektronisch einreichen.
E-Vergabe: Ziele und noch offene Herausforderungen
Das Ziel der Europäischen Kommission ist es, einen europaweiten elektronischen Binnenmarkt zu etablieren. So hätten Unternehmen die Möglichkeit, bspw. durch eine einfache elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge ihre Dienstleistungen und Produkte überall in der EU anzubieten und zu verkaufen.
Ihre Strategie zur Einführung der E-Vergabe in der EU hat die Kommission bereits in der Mitteilung vom 24. April 2014 vorgestellt. In dieser hebt sie die erwarteten Vorteile der E-Vergabe hervor:
- Vereinfachung der Vergabeverfahren
- Verkürzung der der Dauer vom Auftrag bis zur Bezahlung
- Verringerung des Verwaltungsaufwandes
- verbesserte Überprüfbarkeit
- Reporting der Vergabeverfahren durch Erstellen von Statistiken etc.
- Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses
- effizientere Verfahren, die zu Einsparungen bei den öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen führen
Ein wesentliches Problem zur Realisierung ist die fehlende Interoperabilität der verschiedenen technischen IKT-Systeme. Gleichzeitig fehlt den Unternehmen eine Normung oder ein technischer Standard für die elektronische Kommunikation. Die EU-Kommission hat sich deshalb sog. delegierende Rechtsakte vorbehalten, um die Anwendung bestimmter technischer Standards verbindlich zu machen.
Elektronische Rechnung wird im öffentlichen Auftragswesen verpflichtend
Für Bundesministerien und Verfassungsorgane wurde die Verordnung ab dem 27. November 2018 verpflichtend. Ab diesem Zeitpunkt mussten sie elektronische Rechnungen akzeptieren. Die Ausstellung elektronischer Rechnungen wurde jedoch erst ab dem 27. November 2020 verpflichtend.
Wie müssen eingehende elektronische Rechnungen geprüft werden?
Eingehende Elektronische Rechnungen müssen auf folgende Charakteristika hin überprüft werden:
- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Übereinstimmung mit den vereinbarten Konditionen
Die jeweiligen Prüfungsschritte und das entsprechende Prüfungsergebnis müssen in einem elektronischen Prüfprotokoll dokumentiert werden. Häufig werden dazu entsprechende Dokumentenmanagementsysteme eingesetzt, die wenigstens eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aufweisen.
→ Mehr zum Thema Elektronische Abrechnung finden Sie hier.
E-Forms werden ab Oktober 2023 zum europaweiten Standard
Die EU-Standardformulare für oberschwellige Verfahren (eForms) werden ab 25. Oktober 2023 zur Pflicht (vgl. www.bescha.bund.de). Die bundesdeutsche e-Vergabe-Plattform wird aufgrund dessen vom 16.10 bis 24.10 einer Wartung/ Umstellung unterzogen. Wichtig dabei: die E-Vergabe schläft während diesem Zeitpunkt nicht, d.h. es kann weiterhin online ausgeschrieben und beworben werden – bis auf den 24.10. der bislang als sog. Releasetag geplant ist..
→ Wichtig für die Auftraggeber ist jedoch, dass keine Teilnahme- oder Angebotsfristen in diesen Zeitraum gelegt werden (gilt sowohl für unterschwellige und oberschwellige Verfahren).
E-Vergabe für Feuerwehr und Bauhof oder doch lieber analog?
Ein formuliertes Ziel der E-Vergabe soll die Vereinheitlichung und Daten-Übertragbarkeit sein. Wenn es jedoch darum geht, detaillierte Bedarfsausschreibungen, à la Fahrzeuge samt Ausstattung, Schutzausrüstungen et cetera, fehlerfrei wiederzugeben, spielen vor allem Gewohnheit und Möglichkeit eine große Rolle. Gewöhnt sind die meisten Mitarbeiter von Feuerwehren und Bauhöfen bislang nicht an E-Vergabeverfahren.
Möglich ist es aber nur auf wenigen Vergabeplattformen durch Vorauswahlmöglichkeiten Zeit einzusparen. Aus der Praxis dringen deshalb immer wieder Aussagen in die Öffentlichkeit, inwiefern die Ausschreibung einmal vollständig auf Papier oder am Computer geschrieben werden müsse, spiele zeittechnisch keine Rolle, da es denselben Arbeitsaufwand mit sich bringen würde. Und bei der analogen Papierausschreibung seien die Gewohnheit und somit eine geringere Fehleranfälligkeit gegeben.
Klar ist aber dennoch, dass sich diese Systeme und Plattformen mit den Ansprüchen der Feuerwehren und Bauhöfe weiterentwickeln werden. Deswegen wäre es sicherlich nicht schlecht, bereits jetzt den ein oder anderen Blick darauf zu werfen.
Für alle anderen Teilbereiche gibt es das Online-Seminar „Vergaberecht für Feuerwehr und Bauhof, indem vor allem Zeitersparnis mit fehlerfreier Beschaffung im Mittelpunkt stehen. → Vergabe und Beschaffung müssen nicht kompliziert sein – mit diesem Seminar bekommen Sie in nur einem Tag all das Handwerkzeug vermittelt, das zur erfolgreichen Durchführung einer Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung notwendig ist.
Quellen: "Das neue Vergabrecht", https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/elektronische-vergabe.html, https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/, https://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/, https://www.bescha.bund.de/e-Vergabe