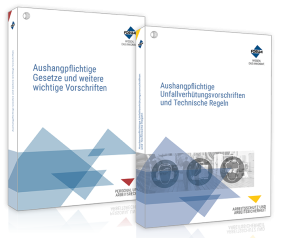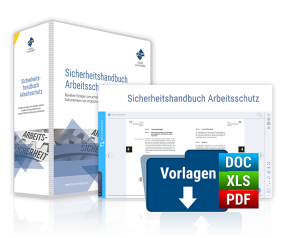Brandschadensanierung: Analyse und Technik unter Berücksichtigung von Lithium-Ionen-Batteriebränden
07.04.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Brandschäden sind eine der größten Herausforderungen für Arbeitsschutz und Bau. Die Sanierung erfordert nicht nur technisches Fachwissen, sondern eine präzise Planung, damit strukturelle Schäden behoben, Schadstoffe entfernt und die betroffenen Gebäude wieder bewohnbar werden. Dieser Leitfaden beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Brandschadensanierung – von Sofortmaßnahmen bis hin zu innovativen Technologien – und bietet praxisnahe Informationen für erfahrene Fachkräfte.
Inhaltsverzeichnis
- Brandschadensanierung: Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsmaßnahmen
- Brandschadensanierung: Schadensbewertung und Sofortmaßnahmen
- Reinigungstechnologien und Rußentfernung im Rahmen der Brandschadensanierung
- Brandschadensanierung: Dekontamination und Geruchsneutralisation
- Brandschadensanierung: Zeitplanung und Kostenkalkulation
- Fazit zur Brandschadenbewertung
Brandschadensanierung: Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsmaßnahmen
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist eine umfassende Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 524 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen" unerlässlich.
→ Brandstellen gelten grundsätzlich als kontaminierte Bereiche, da durch den Brand gefährliche Schadstoffe freigesetzt werden können. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Identifizierung der Schadstoffe: Alle durch den Brand entstandenen Schadstoffe müssen ermittelt werden. Besonders bei Bränden von Lithium-Ionen-Batterien (LIB) können krebserzeugende Gefahrstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder Schwermetalle freigesetzt werden.
- Festlegung von Gefahrenbereichen: Die betroffenen Bereiche sind gemäß TRGS 524 und VdS 2357 in Gefahrenbereiche (GB 0 bis GB 3) einzuteilen, je nach Art und Konzentration der Schadstoffe sowie der damit verbundenen Gefährdung. Bei Bränden von Lithium-Ionen-Batterien kann wegen der potenziell hohen Schadstoffbelastung häufig von einem Gefahrenbereich GB 3 ausgegangen werden. Eine genaue Einstufung sollte jedoch auf Basis einer fachkundigen Bewertung erfolgen.
- Wiederentzündungsrisiko: Das Risiko einer erneuten Entzündung muss berücksichtigt werden, da es auch Stunden oder Tage nach dem ersten Brand auftreten kann. Mittelfristige Maßnahmen, wie die Überwachung der betroffenen Bereiche und die sichere Lagerung von beschädigten Batterien, sind daher unumgänglich.
- Fachkundige Beratung: Es ist erforderlich, fachkundige Personen hinzuzuziehen, die die Gefährdungsbeurteilung erstellen und die Sanierungsarbeiten begleiten können. Diese Personen sollten über die notwendige Sachkunde gemäß TRGS 524 und DGUV Regel 101-004 verfügen und während der gesamten Arbeiten als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen.
→ Die DGUV Information 205-041 „Brandschutz beim Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien (LIB)“ bietet eine umfassende Informationsquelle für Arbeitgeber, Brandschutzbeauftragte und Arbeitsschutzverantwortliche und sollte bei allen betrieblichen Belangen, auch bei Fremdfirmentätigkeiten, berücksichtigt werden.
Wie läuft eine Brandsanierung ab?
Brandschadensanierung: Schadensbewertung und Sofortmaßnahmen
Die erste Phase nach einem Brand besteht aus der detaillierten Begutachtung der Schäden. Mithilfe von Thermografie, Feuchtigkeitsmessgeräten und chemischen Analysen wird das Ausmaß der Zerstörung ermittelt. Besonders wichtig ist die Sicherung der Immobilie, um weitere Schäden durch Witterungseinflüsse oder instabile Strukturen zu verhindern. Sofortmaßnahmen umfassen:
- Statikprüfung: Einsatz temporärer Stützsysteme zur Stabilisierung tragender Elemente.
- Löschwasserentfernung: Installation von Adsorptionsentfeuchtern zur Vermeidung von Schimmelbildung.
- Schadstoffkonservierung: Überziehen metallischer Oberflächen mit Konservierungsöl zur Verhinderung von Korrosion durch Rauchrückstände.
Veranstaltungsempfehlung:
Brände von Lithium-Batterien zählen zu den gefährlichsten Szenarien in der Schadensanierung – hochenergetisch, unberechenbar und schwer zu löschen.
Wie man diesen Risiken bei E-Ladestationen wirkungsvoll begegnet, vermittelt das Online-Live-Seminar „Brandschutz bei E-Ladestationen“. Gleich hier anmelden!
Brandschadensanierung: Dekontamination und Geruchsneutralisation
Nach einem Brand bleibt mehr zurück als verkohlte Wände und beschädigte Möbel: Giftige Rückstände wie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und hartnäckige Rauchgerüche setzen sich tief in Materialien fest. Die Sanierung erfordert spezialisierte Verfahren, um Schadstoffe zu entfernen und Räume wieder bewohnbar zu machen.
Moderne Methoden kombinieren dabei chemische, physikalische und oxidative Prozesse, um Gesundheitsrisiken durch PAK und persistente Geruchsmoleküle zu eliminieren.
Dekontamination toxischer Brandrückstände
PAK wie Benzo[b]fluoranthen (1,30 μg/mg) und Benzo[a]pyren entstehen bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien und penetrieren poröse Oberflächen. Ihre Kanzerogenität erfordert spezifische Reinigungstechnologien:
| 1. Alkalische Reiniger (pH 12,5): |
|
| 2. Thermische Desorption: |
|
| 3. Soda-Strahltechnik: |
|
Brandschadensanierung und Geruchsneutralisation
Rauchgerüche stammen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), gegen die konventionelles Lüften kaum hilft, die folgenden Methoden zur Geruchsneutralisation hingegen schon:
| Methode | Mechanismus | Effizienz |
| Ozon (O₃) | Oxidation von VOC zu CO₂/H₂O | 85 bis 95 Prozent in 4 bis 10 Stunden |
| Hydroxylradikale | Katalytische Zersetzung bei Umgebungstemperatur | 90 Prozent VOC-Reduktion |
| Aktivkohlefilter | Adsorption an 534.438 m²/g Oberfläche | 99 Prozent Geruchsbindung |
Kombinierte Ansätze (zum Beispiel Ozon + Aktivkohle) eliminieren 99,7 Prozent der Geruchsmoleküle durch Synergieeffekte. Hydroxylgeneratoren ermöglichen dabei bewohnte Räume während der Behandlung.
Gesundheitsrelevanz
Wie die National Library of Medicine feststellt, erhöht eine PAK-Exposition das Krebsrisiko auf 1,2 × 10⁻¹ – ein Wert, der 120.000-fach über dem Grenzwert (1 × 10⁻⁶) liegt. Dekontaminationsverfahren müssen daher Residualkonzentrationen unter 0,01 μg/mg sicherstellen, insbesondere bei Dibenzo[a,h]anthracen. Aktuelle Studien zeigen, dass Schutzausrüstungen zwar 99 Prozent der PAK blockieren, jedoch Kontaminationsverschleppungen durch Adsorption an Textilien auftreten.
Veranstaltungsempfehlung:
Nach einem Brand ist eine fachgerechte Schadensanierung entscheidend, um Sicherheit, Gesundheit und Werterhalt zu gewährleisten.
Vertiefende Einblicke und aktuelle Entwicklungen dazu bietet der „Work Safety Day 2025 | Jahrestagung Arbeitsschutz“. Jetzt direkt hier anmelden!
Wie lange dauert die Sanierung nach einem Brand? Und was kostet eine Brandschadensanierung?
Brandschadensanierung: Zeitplanung und Kostenkalkulation
Die Dauer der Sanierung hängt von der Schadensgröße ab:
- Kleinbrände (<10 m²): Sanierung in 3-4 Tagen möglich.
- Mittelbrände (50-500 m³): Erfordern bis zu 12 Wochen aufgrund umfangreicher Reparaturarbeiten.
- Großbrände (>500 m³): Beanspruchen bis zu 18 Monate durch den Einsatz mehrerer Gewerke.
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten:
| Schadenskategorie | Kostenrahmen | Hauptkostenfaktoren |
| Kleinbrand | 3.000 bis 15.000 Euro | Geruchsneutralisation, Teilersatz von Leitungen |
| Mittelbrand | 15.000 bis 75.000 Euro | Statiksanierung, Fensteraustausch |
| Großbrand | ab 75.000 Euro | Asbestsanierung, Neubauplanung |
Reinigungstechnologien und Rußentfernung im Rahmen der Brandschadensanierung
Die Entfernung von Ruß und Schadstoffen nach einem Brand erfordert spezialisierte Reinigungstechnologien, die auf unterschiedliche Materialien und Schadensausmaße abgestimmt sind. Moderne Methoden ermöglichen effiziente Lösungen für eine gründliche und materialschonende Brandschadensanierung:
| Verfahren | Vorgehen |
| Handwischverfahren | Das Handwischverfahren ist besonders effektiv bei kleinen Flächen und schwer zugänglichen Stellen wie Ecken und Ritzen. Feuchte Reinigungslösungen neutralisieren Schadstoffe direkt auf den Oberflächen und entfernen Ruß gründlich. |
|
Heißwasser-Druckverfahren |
Für großflächige Arbeiten eignet sich das Heißwasser-Druckverfahren, bei dem unter Hochdruck heißes Wasser eingesetzt wird, um Brandrückstände zu lösen. Diese Methode ist jedoch nur bei wasserresistenten Materialien anwendbar und erfordert sorgfältige Abdeckungen empfindlicher Bereiche. |
| Trockeneisstrahlen |
Das Trockeneisstrahlen ist eine umweltfreundliche Methode, die Rußablagerungen ohne Abrieb entfernt. Es eignet sich besonders für historische Bauten und empfindliche Materialien wie Holz. |
| Sandstrahlen | Beim Sandstrahlen werden Oberflächen mechanisch gereinigt, wobei feiner Sand als Strahlmittel dient. Diese Methode ist effektiv bei tiefen Verunreinigungen, verursacht jedoch Staubentwicklung und kann Oberflächen beschädigen. |
Innovative Technologien in der Brandschadensanierung
Robotergestützte Reinigungssysteme: Autonome Drohnen mit Nanospray-Düsen dekontaminieren schwer zugängliche Bereiche wie Industrieanlagen effizient und schonend.
Künstliche Intelligenz zur Schadensanalyse: Neuronale Netze analysieren Brandmuster in Echtzeit und prognostizieren Materialermüdung durch thermische Belastungen mit hoher Genauigkeit.
Vakuumstrahlverfahren: Dieses Verfahren nutzt biologisch abbaubare Strahlmittel ohne Chemikalien oder Wasser, wodurch Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Fazit zur Brandschadenbewertung
Die Brandschadensanierung ist ein komplexer Prozess, der technisches Know-how, innovative Technologien und präzise Planung erfordert. Für Bauprofis bietet sie die Möglichkeit, Sicherheit und Funktionalität nachhaltig wiederherzustellen – sei es durch moderne Reinigungstechnologien oder durch die Integration prädiktiver Algorithmen in den Sanierungsprozess.
Mit zunehmenden Risiken durch Elektromobilität und Photovoltaikanlagen sowie den damit verbundenen Bränden von Lithium-Ionen-Batterien wird die Expertise in Brandschadensanierung immer wichtiger für die Bauwirtschaft. Die Einhaltung der TRGS 524 und die Berücksichtigung der DGUV Information 205-041 sind dabei unerlässlich.
Quellen: „Sicherheitshandbuch Arbeitsschutz“