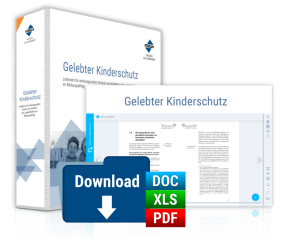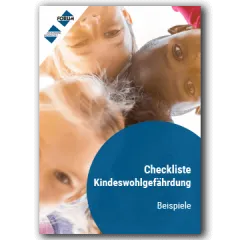Adultismus in der Kita – wie Erwachsene Kinder diskriminieren
29.10.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Damit das Zusammenleben im Kita-Alltag funktioniert, braucht es Regeln für Kinder und Erwachsene. Dabei verhalten sich die Erwachsenen nicht selten diskriminierend gegenüber den Kindern – sei es bei der Wortwahl, im Tonfall oder bei der Gestaltung des Tagesablaufs. Dieser sogenannte Adultismus geschieht oft unbewusst, kann jedoch den Kindern und letzlich der gesamten Gesellschaft schaden. Deshalb sollten sich Pädagoginnen und Pädagogen mit Adultismus in der Kita auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Adultismus einfach erklärt?
- Welche Beispiele gibt es für Adultismus in der Kita?
- Kritik und mögliche Gefahren
- Wie kann Adultismus in der Kita vermieden werden?
Was ist Adultismus einfach erklärt?
Der Begriff „Adultismus“ beschreibt die Diskriminierung von Kindern durch Erwachsene aufgrund ihres Alters. Diese Herabsetzung kann in sämtlichen sozialen Situationen erfolgen, sei es Zuhause oder in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kitas. Dabei erfolgt der (oft ungewollte) Machtmissbrauch vor allem gegenüber jüngeren Kindern, da sich die Älteren ihnen oftmals überlegen fühlen. Aber auch Bequemlichkeit und pauschalisierende Vorannahmen können Auslöser für adultistisches Verhalten sein.
Solch adultistische Verhaltensweisen können sich in bestimmten Aussagen gegenüber Kindern äußern, aber auch grundlegende Strukturen des Bildungswesens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens betreffen. Gerade Bildungseinrichtungen wie Kitas können Orte von Adultismus sein, da sich die Kinder dort an viele von Erwachsenen vorgegebene Regeln und Abläufe halten müssen. Gleichzeitig bleibt häufig wenig Platz für die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Kinder.
Haben bereits ältere Kinder oder Jugendliche adultistische Strukturen verinnerlicht, können auch sie sich entsprechend diskriminierend gegenüber anderen Kindern verhalten. Dieser Beitrag fokussiert sich allerdings auf den Adultismus, der von Erwachsenen, insbesondere von pädagogischen Fachkräften und anderen Angestellten, ausgeht.
Dabei geschieht das Phänomen des Adultismus im Alltag meist unbewusst und wird in unserer Gesellschaft weitestgehend normalisiert. Umso wichtiger ist es, dass sich Pädagoginnen und Pädagogen für solch diskriminierendes Verhalten sensibilisieren, indem sie sich zum Beispiel über typisch adultistische Sätze und Muster informieren.
Welche Beispiele gibt es für Adultismus in der Kita?
Adultismus zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen des Kita-Alltags:
| Bereich | Beispielhafte Sätze/Aussagen | Erläuterung/Wirkung auf das Kind |
| Allgemeine Wortwahl und Tonfall |
|
|
| Vergleiche und Etikettierungen |
|
|
| Zeitdruck und Struktur |
|
|
| Regeln und Sanktionen |
|
|
| Emotionale Invalidierung |
|
|
| Körperliche Selbstbestimmung |
|
|
Eine Herausforderung des Kita-Adultismus besteht darin, dass sich die Kinder den Aufgaben und Anweisungen der Erwachsenen fügen müssen, aber den Tagesablauf nur selten selbst mitgestalten können. Umgekehrt dürfte es für die meisten Erwachsenen anstrengend sein, sich ausschließlich auf die Wünsche einer anderen Person einzustellen, die weniger von ihren Bedürfnissen versteht als sie selbst. Hier ist entsprechende Aufklärungsarbeit gefragt, zum Beispiel in Form von Fortbildungen und Fachliteratur.
Produktempfehlung
Weitere Informationen zu Adultismus in Bildungseinrichtungen sowie praktische Handlungsempfehlungen finden Kitas im Handbuch „Gelebter Kinderschutz“. Es unterstützt bei der Sensibilisierung des Kita-Personals für den Schutz von Kinderrechten – auch für den Schutz vor Diskriminierung und für die Förderung kindlicher Partizipation. Jetzt informieren!
Kritik am Adultismus und mögliche Gefahren
Adultismus in Kitas und anderen Kontexten wird zunehmend kritisch betrachtet, da er grundlegende Kinderrechte verletzt. Er untergräbt das Prinzip der Partizipation und die Idee von Gleichwürdigkeit in pädagogischen Beziehungen.
Machen Kinder regelmäßig adultistische Erfahrungen, kann dies verschiedene negative Folgen haben:
- Geringes Selbstwertgefühl: Kinder bekommen vermittelt, dass ihre Meinung oder ihr Empfinden weniger zählt.
- Angepasstes Verhalten: Die Kinder ordnen sich schnell unter, um Konflikte zu vermeiden. Sie verlieren ihre Eigeninitiative oder reagieren aggressiver, sei es gegenüber dem Kita-Personal oder anderen Kindern.
- Fehlende Partizipationserfahrungen: Kinder lernen nicht, wie demokratische Mitbestimmung funktioniert.
- Psychische Instabilität: Mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrungen können Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Erkrankungen wie Depressionen begünstigen.
- Erhöhte Gefahr von Grenzüberschreitungen: Die Sensibilität der Fachkräfte für Übergriffe und Machtmissbrauch sinkt, wenn kindliche Grenzen nicht respektiert und eigene Bedürfnisse höher priorisiert werden.
- Verstärkte Diskriminierung: Die Kinder übernehmen das adultistische Werteverständnis, was diese Diskriminierungsform weiter normalisiert. Außerdem lernen sie, dass Unterdrückung in Ordnung ist, was sie anfälliger für weitere Diskriminierung gegenüber anderen Gruppen macht.
Damit widerspricht der Adultismus einem modernen, kindzentrierten Bildungsverständnis. Eine Pädagogik, die sich am Wohl des Kindes orientiert, sollte Machtverhältnisse bewusst reflektieren. Dies sollten auch die Angestellten und Leitungen von Kitas berücksichtigen.
Wie kann Adultismus in der Kita vermieden werden?
Um Adultismus in der Kita zu vermeiden, sollten die Einrichtung und ihre Mitarbeitenden ihre pädagogische Haltung fortlaufend reflektieren. Dabei geht es nicht darum, jede Form von Anleitung oder Grenze für die Kinder zu vermeiden, sondern Macht verantwortungsvoll zu gestalten und ein Zusammenwirken auf Augenhöhe zu ermöglichen.
Konkret können Kitas zum Beispiel folgende Maßnahmen ergreifen:
1. Haltung überprüfen und reflektieren
Pädagogische Fachkräfte sollten ihr eigenes Verhalten regelmäßig hinterfragen:
- Wie spreche ich mit den Kindern?
- Treffe ich Entscheidungen stellvertretend, ohne die Meinung der Kinder einzubeziehen?
- Wie reagiere ich auf kindliche Emotionen?
- Ist es wirklich nötig, ein Kind in einer bestimmten Situation zu kritisieren oder zu sanktionieren?
→ Wenn ja, sollte ich dies möglichst nicht vor anderen tun, um das Kind nicht zu beschämen. - Kann ich die Umgebung verändern, bevor ich vom Kind verlange, sich zu ändern?
Diese Reflexion kann zum Beispiel in Teamgesprächen wie kollegialer Beratung, in Supervisionen oder in Fortbildungen zum Thema Macht und Partizipation stattfinden.
2. Bestehende Regeln prüfen und bei Bedarf anpassen
Auch organisatorische Abläufe können adultistische Muster verstärken. Deshalb sollten die Einrichtungsleitung und die Beschäftigten ihre bisherigen Regeln wie folgt prüfen:
- Dient die jeweilige Regel der eigenen Bequemlichkeit?
- Soll mit ihr die Überlegenheit Erwachsener demonstriert werden?
- Soll dem Kind durch einen Machtkampf seine Machtlosigkeit verdeutlicht werden?
- Dient die Regel wirklich dem Schutz des Kindes?
- Sollte unser Kinderschutzkonzept angepasst werden?
3. Kinder bei der Tagesgestaltung miteinbeziehen
Die Kinder sollten altersgerecht und transparent an Entscheidungen beteiligt werden, die sie betreffen. Möglichkeiten zur Partizipation bestehen zum Beispiel bei der Auswahl von Spielen und Ausflügen, der Essensplanung oder der Gestaltung von Regeln im Gruppenraum. Diese Beteiligung stärkt das Verantwortungsbewusstsein und das Selbstvertrauen der Kinder.
4. Sprache achtsam einsetzen
Sprache formt Beziehungen, auch in stressigen Situationen. Ein respektvoller und wertschätzender Ton signalisiert den Kindern, dass sie gehört und ernst genommen werden. Statt Befehlen helfen Ich-Botschaften und Erklärungen:
→ Anstelle von „Du bist jetzt still, weil ich das sage!“ ist „Ich möchte, dass du jetzt zur Ruhe kommst, damit wir gemeinsam weitermachen können.“ sinnvoll.
Außerdem sollten sich Pädagoginnen und Pädagogen fragen, ob sie dieselbe Wortwahl auch gegenüber Erwachsenen verwenden würden.
5. Gefühle anerkennen und begleiten
Kinder brauchen das Gefühl, dass ihre Emotionen richtig und erlaubt sind. Fachkräfte sollten benennen, was sie wahrnehmen (zum Beispiel „Ich sehe, du bist traurig“) und empathisch reagieren.
6. Grenzen der Kinder respektieren
Körperliche und emotionale Grenzen müssen unbedingt geachtet werden. Kein Kind sollte zu körperlichen Gesten, wie beispielsweise Umarmungen, gedrängt werden.
7. Kollegiale Achtsamkeit fördern
Teams können einander auf adultistische Situationen aufmerksam machen – respektvoll und ohne Schuldzuweisungen. Eine offene Fehlerkultur fördert die Entwicklung.
8. Elternarbeit einbeziehen
Pädagogische Fachkräfte sollten das Bewusstsein für Adultismus auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern thematisieren, etwa in Elterngesprächen. Eltern können dabei unterstützt werden, sensibel mit Machtverhältnissen umzugehen und die Selbstständigkeit ihrer Kinder zu fördern.
Quelle: Handbuch „Gelebter Kinderschutz“