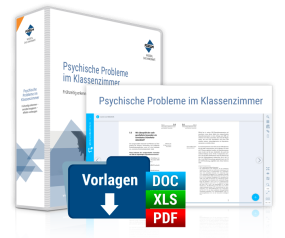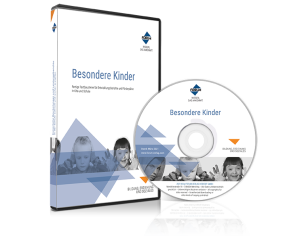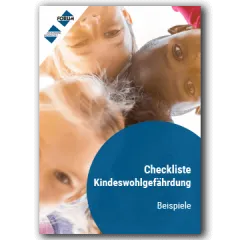Schulangst verstehen: Ursachen, Symptome und Behandlung
03.11.2025 | L. Gschnitzer – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Manche Kinder und Jugendliche empfinden den Schulbesuch als starke Belastung. Schon allein der Gedanke daran kann Unruhe oder körperliche Beschwerden wie Bauchschmerzen auslösen. In solchen Fällen steckt hinter dem Verhalten häufig Schulangst. Die Folge: Betroffene ziehen sich zurück und wollen nicht mehr in die Schule gehen. Doch wie genau können Lehrkräfte und andere Erwachsene Schulangst erkennen und was hilft Kindern und Jugendlichen dabei, es zu überwinden?
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Schulangst?
- Ursachen: Was löst Schulangst aus?
- Symptome: Was sind Anzeichen für Schulangst?
- Was tun bei Schulangst?
Was ist Schulangst?
Schulangst beschreibt Angstreaktionen im schulischen Umfeld. Betroffene Kinder und Jugendliche haben Angst vor Leistungsanforderungen oder sozialen Situationen, wie Prüfungen oder Ablehnung durch Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrkräfte. Diese Ängste führen dazu, dass sie die Schule als belastend empfinden und nicht mehr in den Unterricht gehen möchten oder den Schulbesuch aktiv umgehen (sogenannter Schulabsentismus).
Was steckt hinter Schulangst?
Hinter Schulangst kann eine tieferliegende emotionale Belastung stecken. Betroffene Kinder und Jugendliche erleben Schule dann nicht mehr als einen sicheren Ort, sondern als Umfeld, das Stress, Überforderung oder Druck auslöst.
Dabei zeigt sich Schulangst in unterschiedlichen Altersstufen auf verschiedene Weise. Während in der Grundschule häufig Trennungsängste im Mittelpunkt stehen, kommt es in der Pubertät zu neuen Belastungen. Jugendliche vergleichen sich stärker mit anderen, wollen dazugehören und möchten Erwartungen erfüllen. Dieser wachsende Leistungs- und Sozialdruck kann zu Selbstzweifel und Ängsten führen.
Was ist der Unterschied zwischen Schulangst und Schulphobie?
Sowohl die Schulangst als auch die Schulphobie sind Formen der Schulverweigerung. Bei der Schulangst richtet sich die Angst auf bestimmte Situationen in der Schule. So fürchten sich Betroffene vor Klassenarbeiten, mündlichen Prüfungen oder davor, sich zu blamieren.
Die Schulphobie hingegen ist eine emotionale Störung mit Trennungsangst. Hier bezieht sich die Angst nicht auf die Schule selbst, sondern auf die Trennung von engen Bezugspersonen wie den Eltern. Kinder mit Schulphobie haben die Sorge, dass ihren Eltern etwas zustoßen könnte, während sie in der Schule sind. Diese Form der Schulverweigerung kommt vor allem bei Kindern im Grundschulalter vor und geht mit einer besonders engen Eltern-Kind-Beziehung einher.
Ursachen: Was löst Schulangst aus?
Schulangst entsteht selten durch einzelne Ursachen. Meist wird sie durch verschiedene psychische und soziale Faktoren ausgelöst.
Grundsätzlich lassen sich die Auslöser in folgende Bereiche einteilen:
1. Leistungsbezogene Ursachen
- Angst vor Fehlern oder schlechten Noten
- Überforderung durch zu hohe Leistungsanforderungen oder nicht aufgeholte Wissenslücken (z. B. nach einem Schulwechsel)
- Angst davor, etwas nicht zu verstehen
- Prüfungsangst
- Sorge, sich im Unterricht zu blamieren
2. Ursachen, die die eigene Person betreffen
- Angst vor Ablehnung der Eltern bei schlechten Noten
- Angst davor, dass Geschwister vorgezogen werden, weil sie weniger Probleme verursachen
- Angst davor, dass andere die eigenen Schwächen erkennen
3. Soziale Ursachen
- Angst vor Ablehnung oder Ausgrenzung durch Mitschüler
- Mobbing oder Konflikte in der Klasse
- Sorge, nicht mehr dazuzugehören oder Ansehen zu verlieren
- Angst vor Enttäuschung bestimmter Lehrkräfte
- Angst vor Demütigung wegen schlechter Leistungen
Übrigens: Schulangst kann häufig in Kombination mit anderen Erkrankungen auftreten, wie Depressionen oder Zwangsstörungen.
Symptome: Was sind Anzeichen für Schulangst?
Häufig treten bei Schulangst körperliche Symptome auf. Betroffene Kinder und Jugendliche leiden oft an Bauchschmerzen, Übelkeit oder Kopfschmerzen – vor allem am Morgen vor dem Schulbesuch. Manche klagen auch über Zittern, Schweißausbrüche oder Schlafstörungen.
Neben diesen körperlichen Beschwerden können sich auch soziale Veränderungen zeigen. Betroffene wirken zögerlich und antriebslos. Sie arbeiten sehr langsam oder mit übertriebener Genauigkeit, sodass die Arbeit nicht voran geht. Typisch ist ebenfalls eine „Ja-aber-Haltung“: Kinder sagen zunächst zu, etwas zu tun, nennen dann aber sofort Gründe, warum es doch nicht geht.
Weitere Symptome von Schulangst können sein:
- Häufige Toilettengänge
- Zurückgezogenheit oder Lustlosigkeit (vor allem im Vergleich zu früher)
- Verhaltensauffälligkeiten
- Negative Selbstbewertungen („Ich kann nicht…“)
- Verallgemeinerungen („Alle Lehrer sind unfair“)
- Konzentrationsprobleme
Was tun bei Schulangst?
Damit Kinder und Jugendliche Schulangst überwinden können, müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten – Eltern, Lehrkräfte und die Kinder selbst. Ziel ist es, den Schulbesuch wieder zu ermöglichen und für die Betroffenen sinnvoll zu machen.
Da jede Situation individuell ist, sollte ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen zusammengestellt werden. Dazu zählen regelmäßige Gespräche, die Förderung von Selbstvertrauen und fachliche Unterstützung.
Regelmäßige Gespräche führen
Regelmäßige Gespräche helfen dabei, die Ursachen der Schulangst und des damit einhergehenden Schulabsentismus zu verstehen. Eltern und Lehrkräfte sollten gemeinsam mit dem Kind darüber sprechen, was es belastet und wovor es Angst hat.
Folgende Fragen können dabei helfen:
- Was möchte das Kind mit dem Schulschwänzen erreichen?
- Welche Umstände oder persönlichen Motive haben das Kind dazu bewegt, nicht zur Schule zu gehen?
- Wovor hat es Angst, und was versucht es zu vermeiden?
- Gibt es weitere Bereiche, in denen sich das Kind ähnlich verweigernd verhält?
Diese Gespräche zeigen, wo Unterstützung möglich und ob fachliche Hilfe nötig ist. Gleichzeitig dienen sie dazu, die Beziehung zwischen Kind und Lehrkräften zu stärken. Denn Kinder schwänzen in der Regel seltener, wenn sie eine positive Beziehung zu ihren Lehrerinnen und Lehrern haben, insbesondere zu ihrer Klassenleitung.
Entmutigungsquellen erkennen und abbauen
Kinder mit Schulangst haben oft über längere Zeit Erfahrungen gemacht, die ihr Selbstvertrauen geschwächt haben. Diese Entmutigungsquellen sollten erkannt und durch gezielte Ermutigungsstrategien abgebaut werden.
Häufige Entmutigungsquellen sind:
- Wiederholte Misserfolge und schlechte Noten, die das Gefühl verstärken, nie gut genug zu sein.
- Negative Meinungen über die eigenen Leistungen („Ich kann nicht rechnen“).
- Übermäßige Fürsorge oder fehlende Selbstständigkeit zu Hause, wodurch Kinder kaum lernen, Schwierigkeiten selbst zu lösen.
Fachliche Unterstützung holen
Manchmal braucht es zusätzliche Unterstützung von psychologischen Fachkräften, damit Kinder und Jugendliche die Schulangst überwinden können. So kann eine Leistungs- und Intelligenzdiagnostik dabei helfen, zu klären, wie das tatsächliche Leistungsvermögen der Betroffenen aussieht. Basierend auf den Ergebnissen des Tests werden geeignete Förderpläne erstellt.
Bei Schulangst mit Prüfungsängsten kann eine kognitive Verhaltenstherapie hilfreich sein. In dieser lernen Kinder, ihre Gedanken und Reaktionen auf angstauslösende Situationen zu verändern. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, wie Rollenspiele oder Entspannungstechniken.
Schulische Wiedereingliederung gestalten
Bei Schulangst sollte der regelmäßige Schulbesuch schrittweise wieder aufgebaut werden. Ziel ist es, dass das Kind den Schulalltag als machbar erlebt und positive Erfahrungen sammelt.
Mögliche Ansätze sind:
- Besuch einer Parallelklasse.
- Verkürztes Zeitfenster für den Schulbesuch, das nach und nach ausgeweitet wird.
Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche bei der Rückkehr in den Schulalltag eng begleitet werden. Mit Verständnis und Unterstützung können sie lernen, Schule wieder als sicheren und positiven Ort wahrzunehmen.
Produktempfehlung
Weitere Unterstützung von Kindern mit Schulangst oder anderen psychischen Auffälligkeiten finden pädagogische Fachkräfte im Praxisratgeber „Psychische Probleme im Klassenzimmer“. Er klärt über verschiedene Krankheitsbilder und deren Symtpome auf und bietet passende Maßnahmen zur Stabilisierung und Wiedereingliederung. Jetzt bestellen und die psychische Gesundheit Ihrer Schülerinnen und Schüler fördern!
Quelle: Handbuch „Psychische Probleme im Klassenzimer“