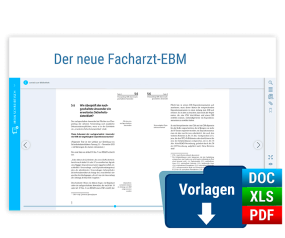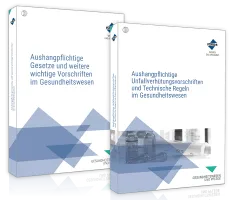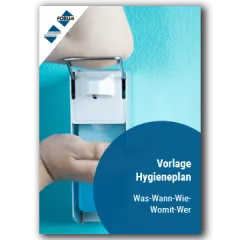Wie viele Dekubitus-Grade gibt es? – Klassen, Risikofaktoren und Maßnahmen
05.11.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Egal, ob ein älterer Mensch im Pflegeheim oder eine bettlägrige Patientin im Krankenhaus – langes Liegen oder Sitzen kann unter Umständen zu einem Dekubitus führen. Zur fachgerechten Einschätzung einer solchen Wunde gibt es sogenannte Dekubitus-Grade. Wie viele es davon gibt, welche Merkmale sie aufweisen und wie eine bedarfsgerechte Behandlung aussieht, zeigt dieser Beitrag.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Dekubitus? – Definition
- Welche Dekubitus-Grade gibt es?
- Risikofaktoren und Assessment
- Dekubitus-Behandlung: Dokumentation und Therapie
Was ist Dekubitus? – Definition
Ein Dekubitus ist ein Druckgeschwür, bei dem ein Teil der Haut und/oder das darunterliegende Gewebe geschädigt sind. Die häufigste Ursache ist langes Liegen oder Sitzen. Dadurch wird hoher Druck auf knöcherne Vorsprünge ausgeübt, also an Stellen, an denen sich der Knochen direkt unter der Haut befindet und kein Gewebe dazwischenliegt. Hierzu gehören zum Beispiel der Hinterkopf, das Steißbein und die Ferse.
Der anhaltende Druck durch das eigene Körpergewicht sorgt dafür, dass die betroffenen Stellen nicht mehr ausreichend durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden. Die Haut wird dünner und es kommt zu einem begrenzten Absterben (Nekrose) der Haut. Die Folge: Es entsteht eine offene Wunde, die nur schlecht und sehr langsam heilt.
Um zu beurteilen, ob ein Dekubitus vorliegt und wie stark dieser ausgeprägt ist, gibt es offizielle Dekubitus-Grade. Gemeinsam mit dem Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe in der Pflege bieten sie Leitlinien für die fachgerechte Prävention, Diagnose und Behandlung von Dekubitus.
Welche Dekubitus-Grade gibt es?
Dekubitus werden je nach Gewebsschädigung, Aussehen und Tiefe der Wunde in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dies ist wichtig für die Dokumentation und die anschließende Abrechnung von Pflegeleistungen. Das dazugehörige und in Deutschland geltende Klassifikationssystem basiert auf Empfehlungen des US National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), des European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) und der Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Es dient insbesondere der Prävention und Behandlung von Druckgeschwüren.
Die aktuelle Dekubitus-Kategorisierung nach NPUAP, EPUAP und PPPIA lautet:
| Dekubitus-Kategorie | Merkmale |
| Kategorie/Stadium 1: Eythem bei intakter Haut |
|
| Kategorie/Stadium 2: Zerstörung der Haut bis in die Dermis |
|
| Kategorie/Stadium 3: Vollständiger Verlust der Haut – Ulkusbildung |
|
| Kategorie/Stadium 4: Vollständiger Haut- und Gewebeverlust |
|
Daneben gibt es noch zwei Sonderkategorien, die jedoch nicht beziffert werden:
| Nicht zuordenbarer Dekubitus: Verdeckter vollständiger Haut- und Gewebeverlust |
|
| Tiefe druckbedingte Gewebeschädigung: Nicht wegdrückbare Verfärbung der Haut |
|
Hinweis: Das NPUAP und das EPUAP empfehlen, statt von Dekubitus-Graden von Dekubitus-Kategorien zu sprechen. Die Einteilung in und Bezeichnung von Schweregraden wurde zwar bereits 1975 von J. B. Shea geprägt, hält sich jedoch bis heute im Sprachgebrauch.
→ Für Gesundheitseinrichtungen ist es wichtig, sich an die Kategorisierung nach EPUAP und NPUAP zu halten und bei der Abrechnung die ICD-10-Kodierung zu beachten.
Risikofaktoren und Assessment
Um das Risiko für eine Dekubitusbildung einschätzen zu können, sollten medizinische Angestellte die Hautbeschaffenheit sowie die Aktivität, Mobilität und Ernährung der pflegebedürftigen Person beobachten.
Folgende Fragen helfen dabei, mögliche Risikofaktoren für einen Dekubitus einzuschätzen:
| Haut- und Gewebeassessment (auch Schleimhäute und Druckgeschwüre durch medizinische HIlfsmittel) |
|
| Einschätzung der Aktivität |
|
| Einschätzung der Mobilität |
|
| Ernährungsassessment |
|
Bei der Risikoeinschätzung für mögliche Dekubitus-Grade sind folgende Körperbereiche besonders gefährdet, einen Dekubitus zu entwickeln:
- Ohrmuschel
- Hinterkopf
- Schulterblatt
- Schultergelenk
- Ellbogen
- Wirbelsäule
- Steißbein/Kreuzbein
- Sitzbein
- Beckenkamm
- Trochanter Major
- Kniegelenk
- Fußknöchel außen und innen
- Ferse
Gratis-Download
Eine vollständige und kostenlose Checkliste zur Dekubitusrisikoerfassung, die Sie bei allen Patientinnen und Patienten neu anwenden können, können Sie hier herunterladen. Sparen Sie jetzt Zeit und Arbeit bei der Risikoerfassung!
Wurde tatsächlich einer der Dekubitus-Grade festgestellt, ist eine entsprechende Therapie erforderlich.
Dekubitus-Behandlung: Dokumentation und Therapie
Jeder Dekubitus muss nach den Richtlinien der Wundbeschreibung exakt beschrieben werden. Nur dann ist es möglich, geeignete Therapiemaßnahmen einzuleiten. Das umfasst neben der Wunddokumentation auch die Erfassung des gesamten Patientenstatus.
| Evaluierung des Patientenstatus bei Dekubitus | |
| Eine erneute Einschätzung nach dem Risikoassessment mit Bestimmung… | |
| ❏ | der Grunderkrankung der Patientin/des Patienten |
| ❏ | des Ernährungsstatus |
| ❏ | der Medikamente |
| ❏ | der Störfaktoren der Wundheilung |
| ❏ | der Schmerzerhebung |
Außerdem ist eine exakte Beschreibung der Wunde erforderlich, die folgende Angaben enthält:
| Wundbeschreibung eines Dekubitus | |
| ❏ | Stadium nach EPUAP |
| ❏ | Wundgröße (Länge, Breite, Tiefe) |
| ❏ | Taschenbildungen, Unterminierungen und Fistelungen |
| ❏ | Beschreibung der Wundheilungsphase |
| ❏ | Beschreibung von Wundgrund, Wundrand und Wundumgebung |
| ❏ | Lokalisation |
| ❏ | Fotodokumentation empfohlen |
Mithilfe dieser Wundbeschreibung kann das Fachpersonal eine bedarfsgerechte Lokaltherapie erarbeiten. Gemeinsam mit der Kausaltherapie bildet sie die Grundlage der Dekubitusbehandlung.
Kausaltherapie
Die Kausal- oder Ursachentherapie umfasst folgende Faktoren:
- Vollständige Druckentlastung zur Wiederherstellung der Durchblutung durch geeignete Lagerung/Positionierung
- Ernährungsverbesserung (angepasst an den steigenden Energie- und Proteinbedarf)
- Schmerztherapie (bei der Lagerung, mit speziellem Material, durch Medikamentengabe von Schmerzmitteln)
- Verbesserung des Allgemeinzustandes (ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Mobilisierung)
- Wundtherapie (umfassende Erstbeurteilung, Erstellung eines Behandlungsplan, regelmäßige Neubewertung)
Lokaltherapie
Zur Lokaltherapie gehören folgende Maßnahmen:
- Auswahl der Verbände und Wundauflagen
- Chirurgisches Débridement zur Nekroseentfernung (etwa bei Verdacht auf Sepsis, bei Dekubitus-Grad 3 und 4)
- Infektionsbekämpfung (ausreichende Sauerstoffzufuhr)
- Phasengerechte feuchte Wundversorgung
Veranstaltungsempfehlung
Umfangreiches Praxiswissen zur Dekubitus-Behandlung und anderen Wundarten erhalten medizinische Fachkräfte im E-Learning „DEKRA-zertifizierte/r Wundexperte/-expertin“. In 84 Unterrichtseinheiten von je 45 Minuten lernen die Teilnehmenden, wie sie ein zeitgemäßes Wundmanagement gemäß den neuen Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V sicherstellen. Jetzt anmelden und weiterqualifizieren!
Quellen: E-Learning „DEKRA-zertifizierte/r Wundexperte/-expertin“, Institut für Innovationen im Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschung e.V., Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“