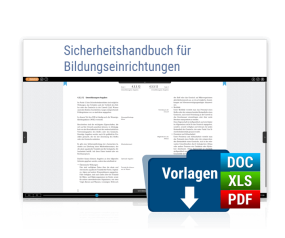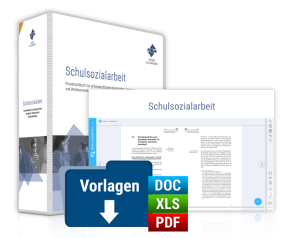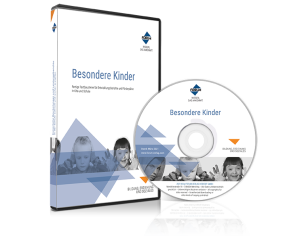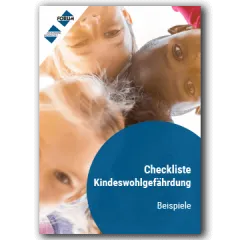Umgang mit Gewalt an Schulen – Statistik, Ursachen und Prävention
14.10.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage schätzen 60 % der Lehrkräfte in Deutschland, dass es an ihrer Schule in den letzten fünf Jahren zu mehr Gewalt kam. Diese Tendenz ist in allen Schulformen, von der Grundschule bis zum Gynmasium, zu verzeichnen. Welche weiteren Statistiken gibt es zu diesem Thema, welche Ursachen stecken dahinter und welche Gegenmaßnahmen können Schulen ergreifen?
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Gewalt an der Schule? – Definition und Formen
- Mehr Gewalt an Schulen? – Statistiken und Studien
- Warum nimmt Gewalt an Schulen zu? – Ursachen
- Was tun bei Gewalt an Schulen? – Prävention und Maßnahmen
Was ist Gewalt an der Schule? – Definition und Formen
An Schulen kann es zu den unterschiedlichsten Formen von Gewalt kommen. Sie kann sowohl von Schülerinnen und Schülern ausgehen als auch von deren Eltern oder den Lehrkräften. Somit erfolgt personelle Gewalt an Schulen meist entweder zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander (Gewalt unter Kindern), zwischen Schülerinnen bzw. Schülern und einer Lehrkraft oder zwischen Eltern und einer Lehrkraft.
Formen von Gewalt an Schulen
Im Schulkontext lassen sich grundsätzlich folgende Verhaltensweisen unterscheiden:
- Verbale Gewalt (Drohungen, Beleidigungen, Erpressung, Nötigung etc.)
- Psychische Gewalt (Mobbing, Ausgrenzung, Ignorieren etc.)
- Körperliche Gewalt (Tritte, Schlägereien, etc.)
- Sexualisierte Gewalt (sexuelle Belästigung/Nötigung/Missbrauch, Peergewalt)
- Gewalt gegen Sachen (Sachbeschädigung von Autos oder Schulinventar, Raub etc.)
Doch wie häufig kommt es zu solcher Gewalt an Schulen? Was sagt die Forschung?
Mehr Gewalt an Schulen? – Statistiken und Studien
Ja, die Gewalt an Schulen nimmt zu – zumindest teilweise. Laut einer Auswertung des deutschen Schulportals stieg die Zahl polizeilich erfasster Gewalttaten an Schulen von 2022 bis 2024 bundesweit um durchschnittlich 37,1 %. Die größten Zunahmen gab es in Bremen (+72,6 %), Sachsen (+65,6 %) und Thüringen (+64,0 %). Zu den darin erfassten Gewaltformen gehören leichte Körperverletzung und Gewaltkriminalität (Bedrohung, räuberische Erpressung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung). Grundlage dieser Zahlen ist die Polizeiliche Kriminalstatistik.
→ Hinweis: Die Zahlen der PKS lassen sich zwischen den Bundesländern sowie zwischen den Jahren nur eingeschränkt vergleichen. Ein Grund dafür ist, dass auch Fälle, in denen es am Ende zu keiner Verurteilung kam, in der Statistik verbleiben. Gleichzeitig sind psychische Gewalttaten tendenziell unterrepräsentiert, da sie oft aus Scham nicht angezeigt werden. Außerdem gibt es teils uneinheitliche Definitionen darüber, welche Gewaltvorfälle ein Bundesland als im Zusammenhang mit einer Schule wertet, beispielsweise Taten auf dem Schulweg.
Laut dem Deutschen Schulbarometer 2025 bestätigen ca. 47 % der Lehrkräfte, dass es an ihrer Schule Probleme mit physischer und psychischer Gewalt gibt (gleicher Wert wie 2024). In einer Umfrage der DGUV von September 2024 gaben zudem 56 % der Befragten an, seit der Pandemie mehr psychische Gewalt unter Schülerinnen und Schülern zu erkennen als zuvor. Die Umfrage zeigt ebenso, dass Lehrkräfte an Gymnasien seltener von psychischer und körperlicher Gewalt berichten als Lehrkräfte anderer Schulformen.
Auch Gewalt gegen Lehrer und Lehrerinnen steigt
In einer im Dezember 2024 durchgeführten forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) wurden Schulleitungen befragt, ob und welche Gewalttaten in den vergangenen fünf Jahren (2019 bis 2024) in ihrer Schule auftraten. Das sind die bundesweiten Ergebnisse:
-
Persönliche Gewaltattacken gegen Lehrkräfte: Bundesweit an 65 % aller Schulen
- Umfasst direkte Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, Mobbing, Belästigung.
- Verglichen mit der Zahl von 2018 (48 %) ist das ein Anstieg um rund 35 % in sechs Jahren.
- Gehen meist von folgenden Parteien aus:
- Eltern (79 % der Fälle)
- Schülerinnen und Schüler (66 %)
- Andere Lehrkräfte (13 %)
-
Gewaltattacken gegen Lehrkräfte über das Internet (Cybermobbing):
- 2018: 20 % der Schulen, 2024: 36 %
- Auslösende Parteien:
- Schülerinnen und Schüler (72 %)
- Eltern (56 %)
- Andere Lehrkräfte (5 %)
-
Körperliche Angriffe gegen Lehrkräfte:
- 2018: 26 % der Schulen, 2024: 35 %
- Auslösende Parteien:
- Schülerinnen und Schüler (97 %)
- Eltern (11 %)
- Andere Lehrkräfte (1 %)
Die Statistiken zeigen: Gewalt an Schulen ist ein ernstzunehmendes Problem. Doch welche Ursachen stecken hinter einem solchen Verhalten?
Warum nimmt Gewalt an Schulen zu? – Ursachen
Wie so oft gibt es zahlreiche mögliche Ursachen für Gewalt an Schulen.
Der im Juni 2025 veröffentlichte „Kinder- und Jugendgesundheitsbericht Sachsen-Anhalt“ definiert zum Beispiel folgende Einflussfaktoren, die dazu führen, dass insbesondere Jugendliche gewalttätig werden:
- Erhöhtes sogenanntes „Sensation Seeking“ (Drang nach neuen und intensiven Erfahrungen)
- Geringere Fähigkeit zur Risikoeinschätzung
- Verringerte Affekt- und Impulskontrolle
- Soziales Umfeld
- Erziehungsmuster von zu Hause
- Schlechtes Verhältnis zu den Eltern, familiäre Konflikte
- Vernachlässigung, Kindeswohlgefährdung
- Peergruppen-Effekte
- Suche nach sozialer Anerkennung
- Sozioökonomische Benachteiligung
- Individuelle Faktoren
- Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder psychische Erkrankungen wie Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen
- Schulische Probleme
- Erfahrung mit Mobbing
- Geschlecht*
*Laut dem Bericht aus Sachsen-Anhalt ist das Risiko, ein aggressives Verhalten zu entwickeln, bei Jungen insgesamt höher als bei Mädchen. Auch würden Jungen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Gewalt auf Belastungssituationen reagieren als Mädchen.
Umso wichtiger ist es, dass Schulen und Lehrkräfte die persönlichen Sorgen und Herausforderungen ihrer Schülerinnen und Schüler ernst nehmen. Das gilt insbesondere für Kindern und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf oder psychischen Auffälligkeiten.
Produktempfehlung
Wie Lehrkräfte mögliche Förderbedarfe von Schülerinnen und Schülern erkennen, zeigt die Software „Besondere Kinder“. Sie enthält fertige Textbausteine, mit denen sich Entwicklungsberichte und Förderpläne erstellen lassen.
Und worauf beim Umgang mit psychisch kranken Heranwachsenden zu achten ist, erklärt der Praxisratgeber „Psychische Probleme im Klassenzimmer“. Jetzt informieren!
Nachdem nun die aktuellen Zahlen und mögliche Ursachen bekannt sind, stellt sich die Frage, wie die Einrichtungen der Gewalt an Schulen entgegenwirken können. Welche Maßnahmen gelten im Ernstfall?
Was tun bei Gewalt an Schulen? – Prävention und rechtliche Maßnahmen
Bei akuten Fällen von Gewalt an Schulen können zahlreiche (rechtliche) Schritte ergriffen werden, von schulinternen Disziplinarverfahren bis hin zur Anzeige bei der Polizei.
Rechtliche Schritte und Konsequenzen
Für die meisten Schulen gibt es spezielle Schulverbindungsbeamtinnen und -beamte der Polizei. Sie können bereits im Vorfeld über etwaige Straftatbestände und den Ablauf einer Anzeige aufklären. Zudem können sich Lehrkräfte und anderes Schulpersonal jederzeit durch die Polizei beraten lassen. Geht es dabei nicht um fiktive Vorfälle, muss die Polizei im Rahmen der Strafverfolgungspflicht jedoch ein Ermittlungsverfahren einleiten (Strafverfolgungspflicht).
Für Kinder und Jugendliche gelten im Falle von Gewalttaten besondere strafrechtliche Regelungen:
| Kinder (bis 13 Jahre) | Jugendliche (14 bis 17 Jahre) |
|
|
→ Weitere Informationen zu den rechtlichen Vorgaben im Umgang mit Gewalt an Schulen finden Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte in dieser Handreichung der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
Ebenso bedeutsam ist es, präventive Methoden zu entwickeln, um Gewalt in der Schule gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Präventionsmaßnahmen für Schulen und Lehrkräfte
Es gibt beispielsweise folgende Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Schulen:
- Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Konzepte erarbeiten (Klassenregeln, Schulordnung, Schulprogramm etc.), die gewaltfreie Kommunikation beschreiben und Konsequenzen bei Verstößen aufzeigen.
- Konkrete Ansprechpersonen für den Ernstfall bestimmen (Schulleitung, Schulaufsicht, Vertrauenslehrkräfte, Schulpsychologin oder Schulpsychologe etc.).
- Anlaufstellen außerhalb der Schule festlegen (Personalrat, Polizei, schulpsychologische Beratungsstellen etc.).
- Fortbildungen für Lehrkräfte organisieren, etwa zum Umgang mit Konflikten von Schülerinnen und Schülern.
- Elternarbeit ausweiten/anpassen (z. B. in Elterngesprächen für das Thema sensibilisieren).
- Projektunterricht gegen Gewalt an Schulen durchführen, z. B. Anti-Gewalt-Training.
- Klassengemeinschaft stärken, um Probleme wie Mobbing oder Ausgrenzung in der Schulklasse zu bekämpfen.
Beim Umgang mit Gewalt an Schulen sind also sowohl die Schulleitungen und Schulträger als auch die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern gefragt. Sie alle können dabei helfen, die Fallzahlen von Gewalt an Schulen langfristig zu senken. Mögliche Unterstützung bieten entsprechende pädagogische Konzepte, wie sie in Handbüchern und Softwareprogrammen beschrieben werden.
Quellen: Deutsches Schulportal, schulische-gewaltpraevention.de, Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes